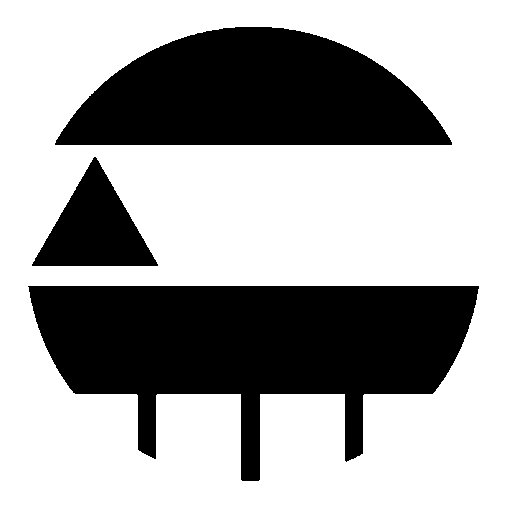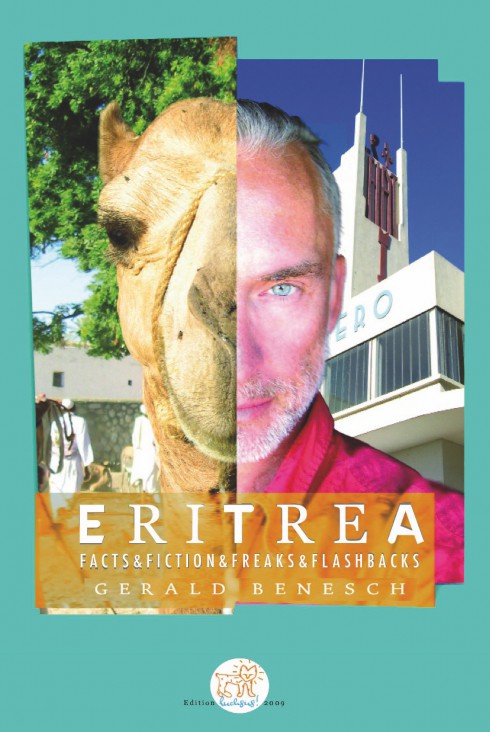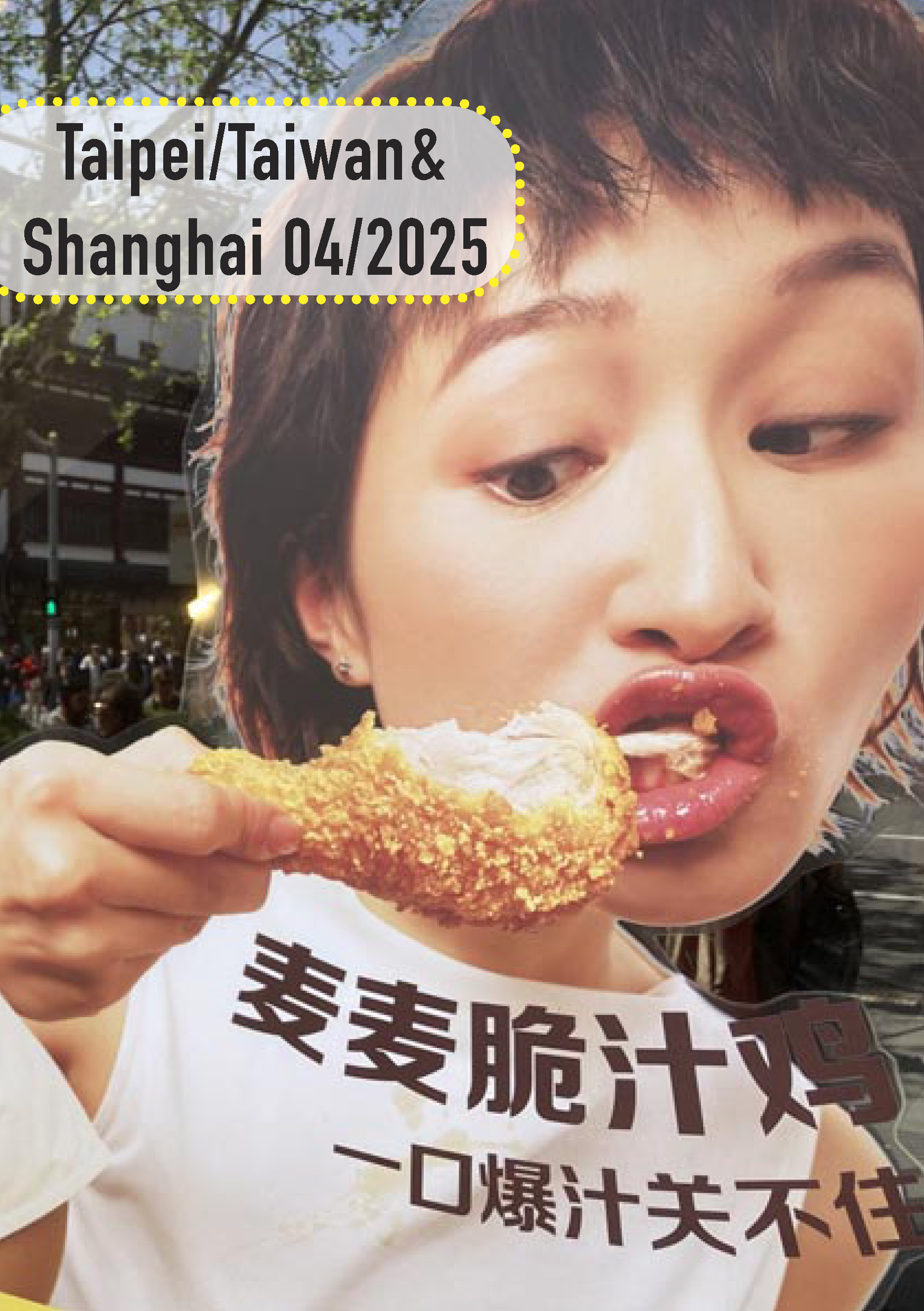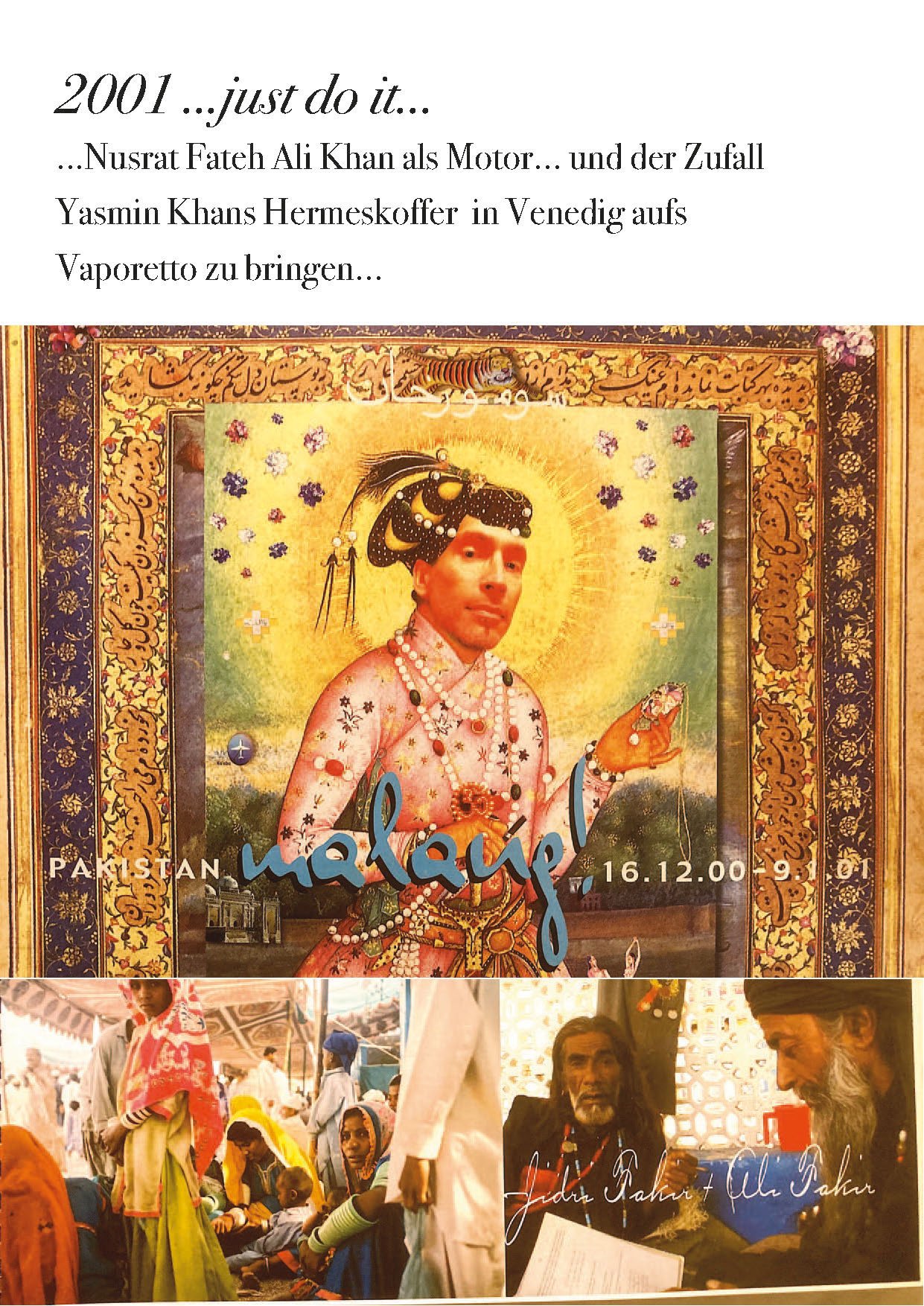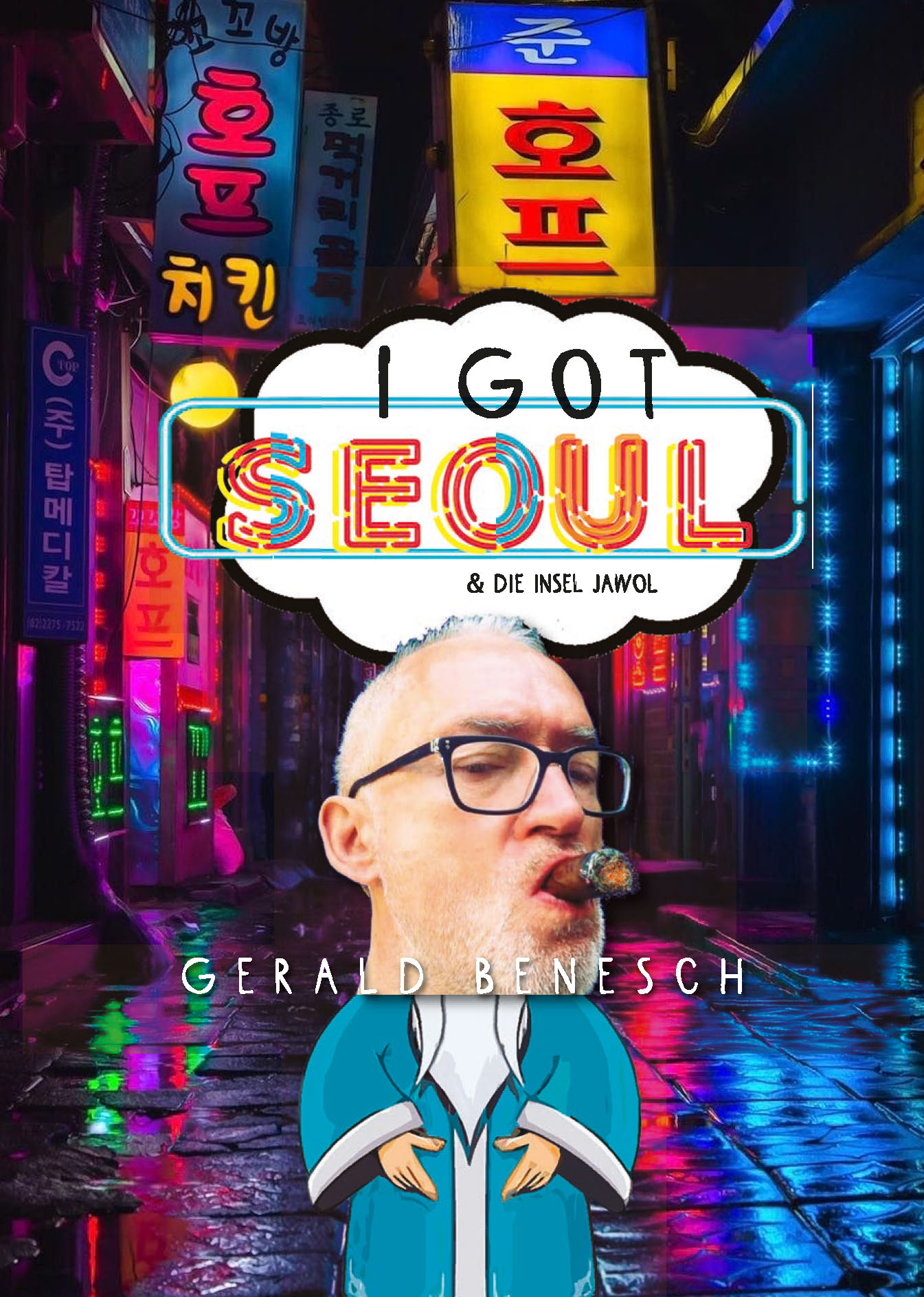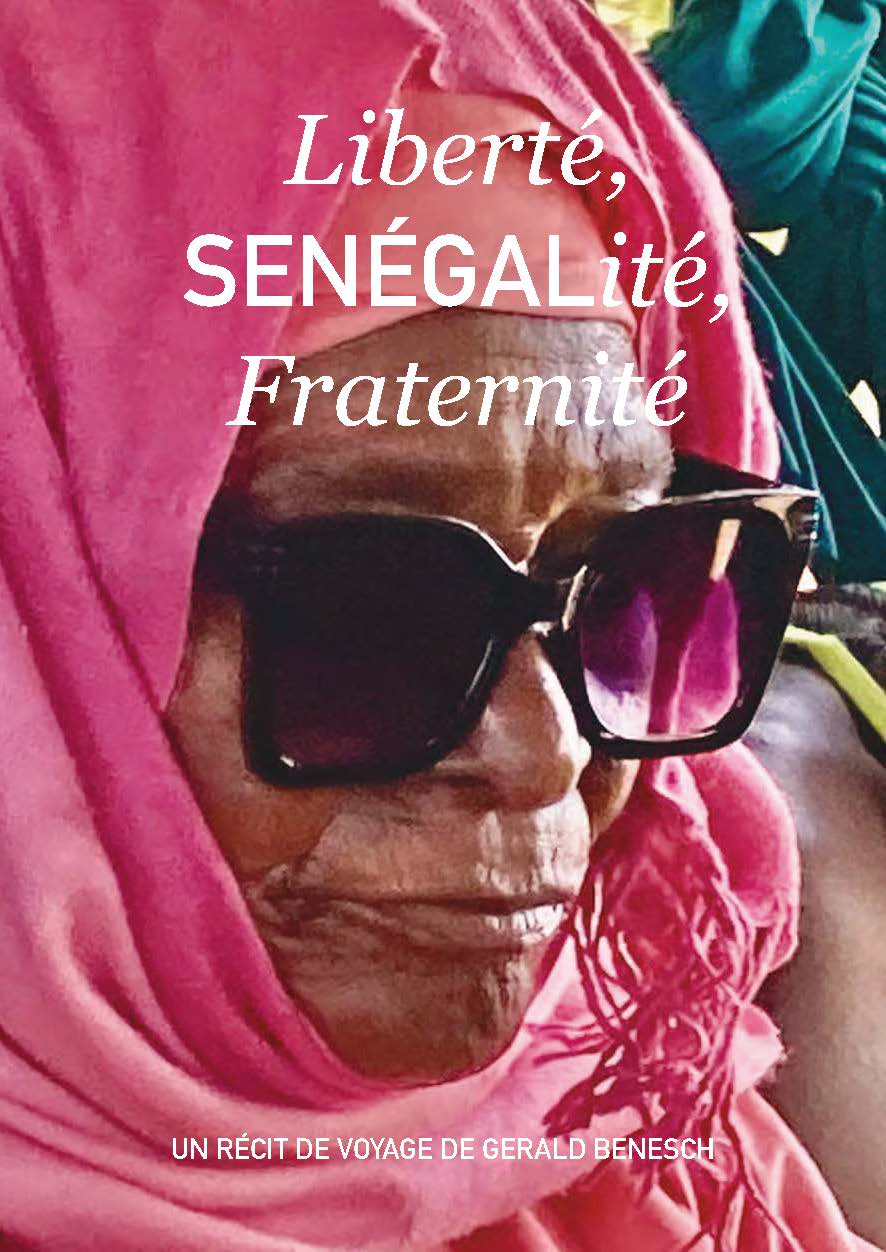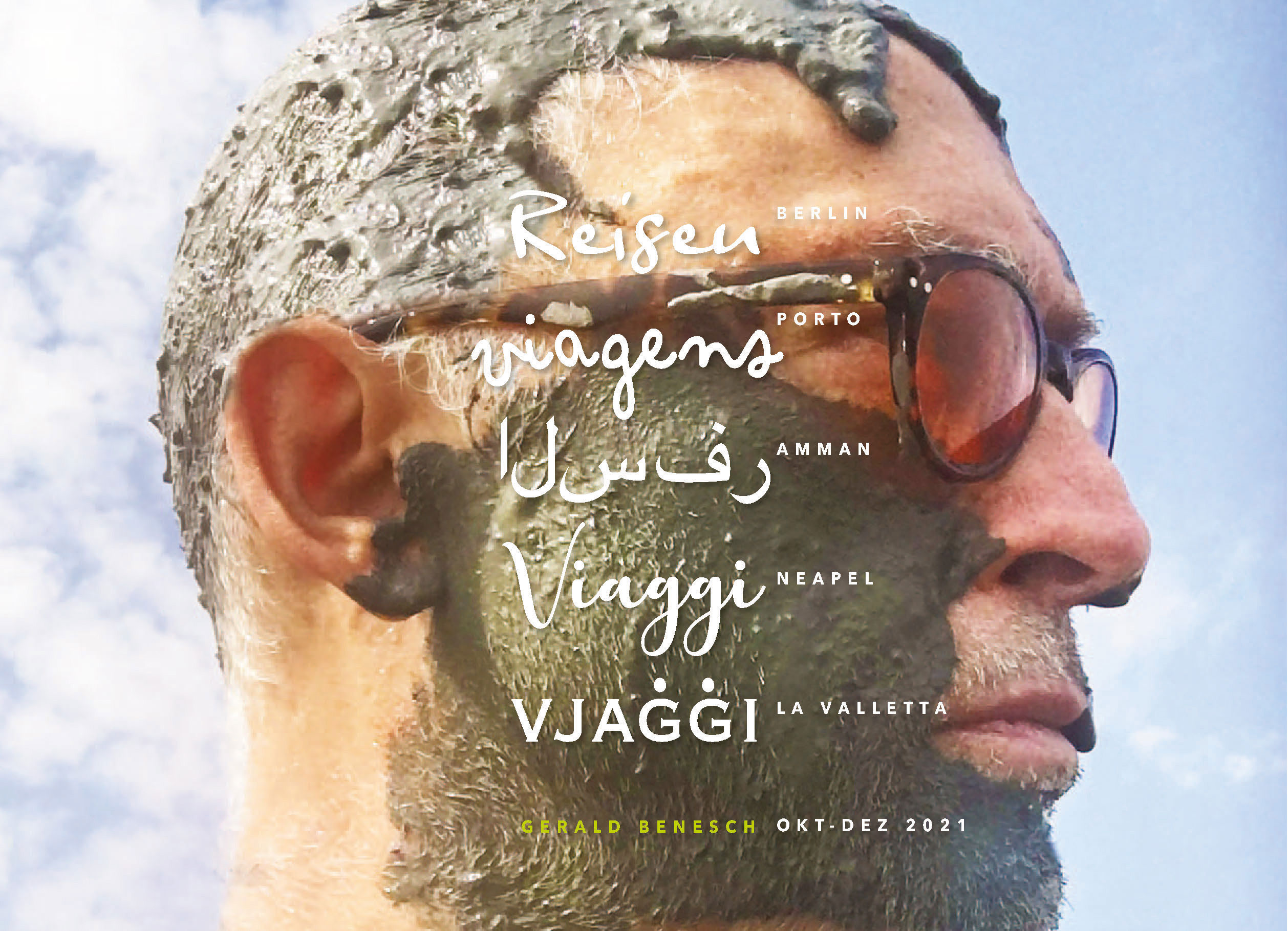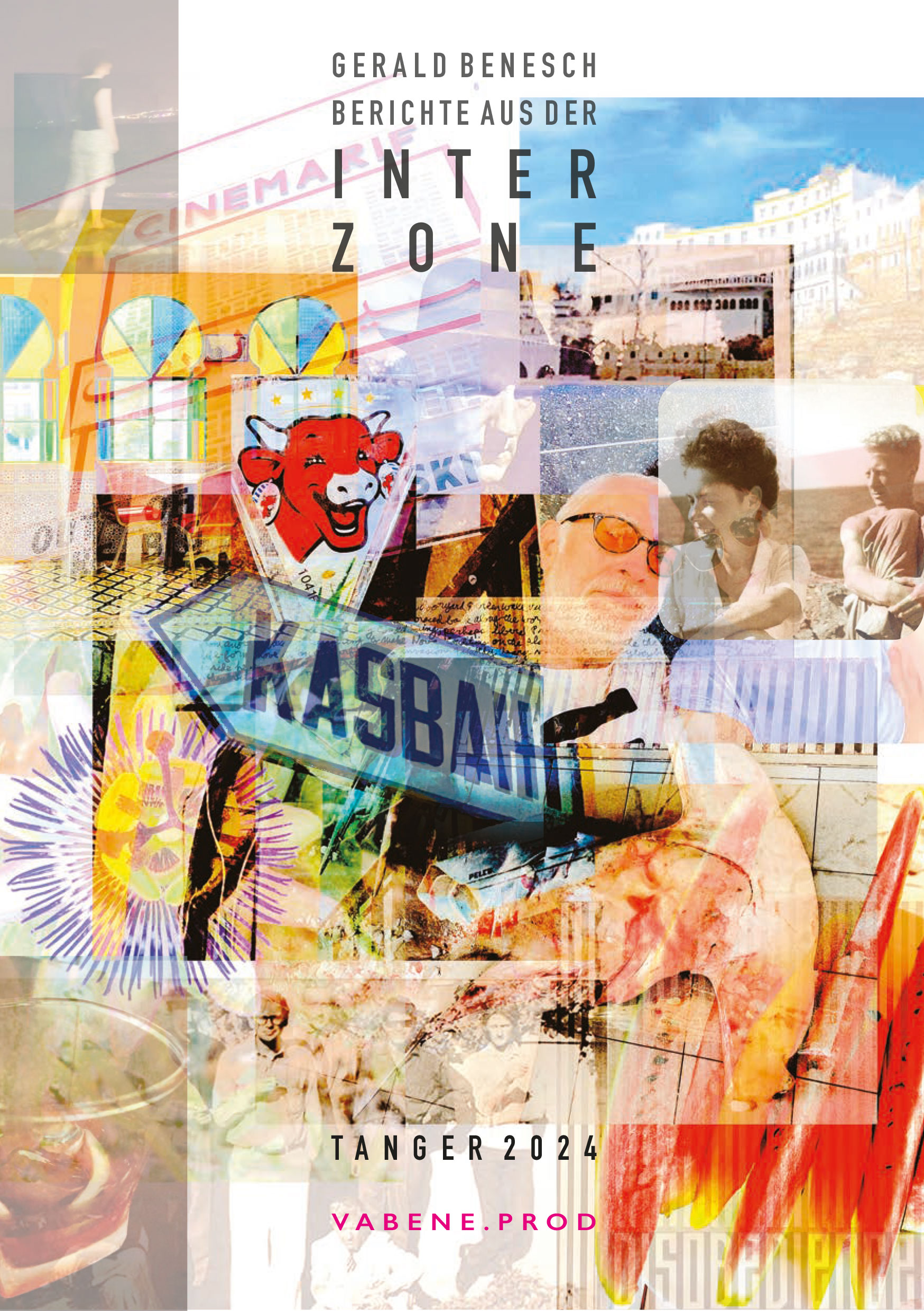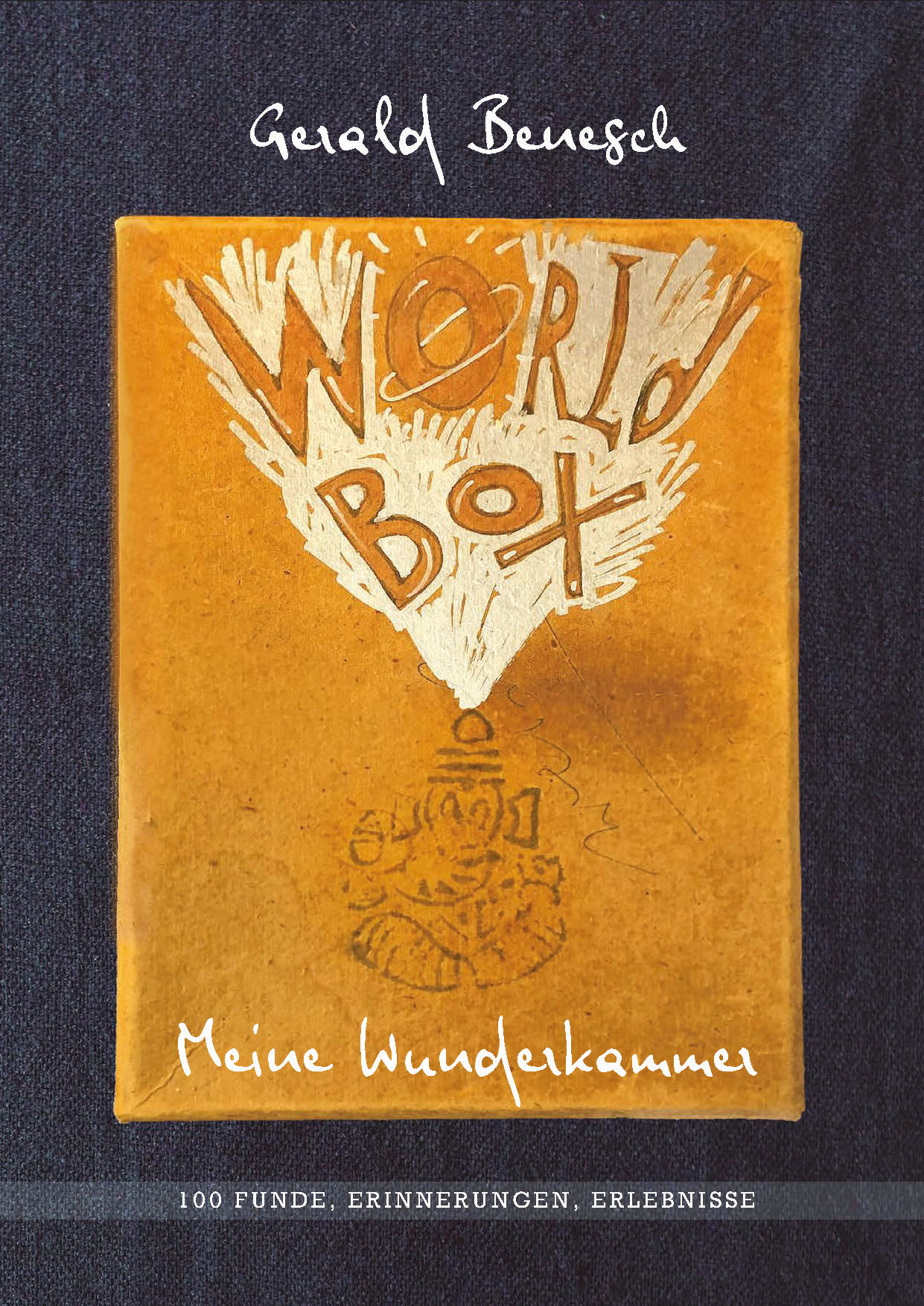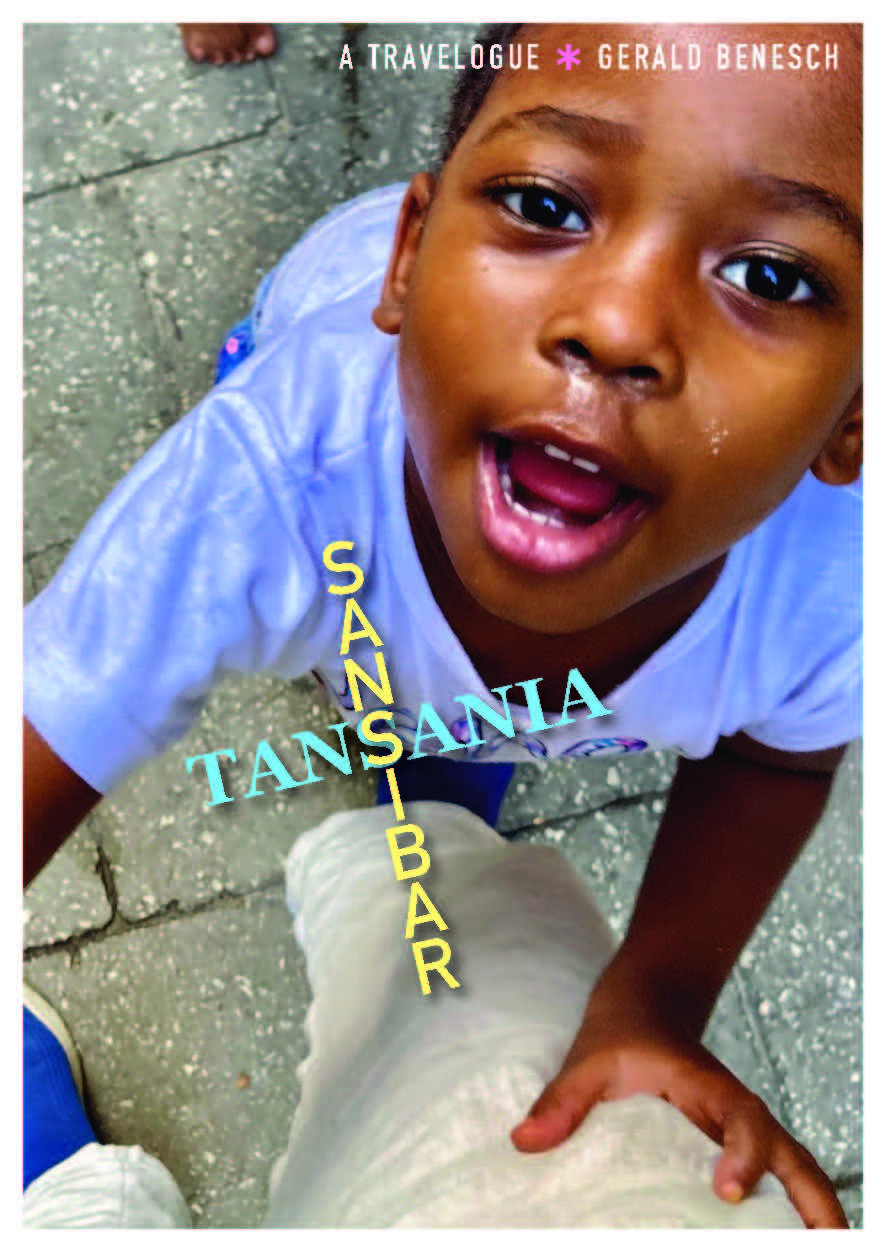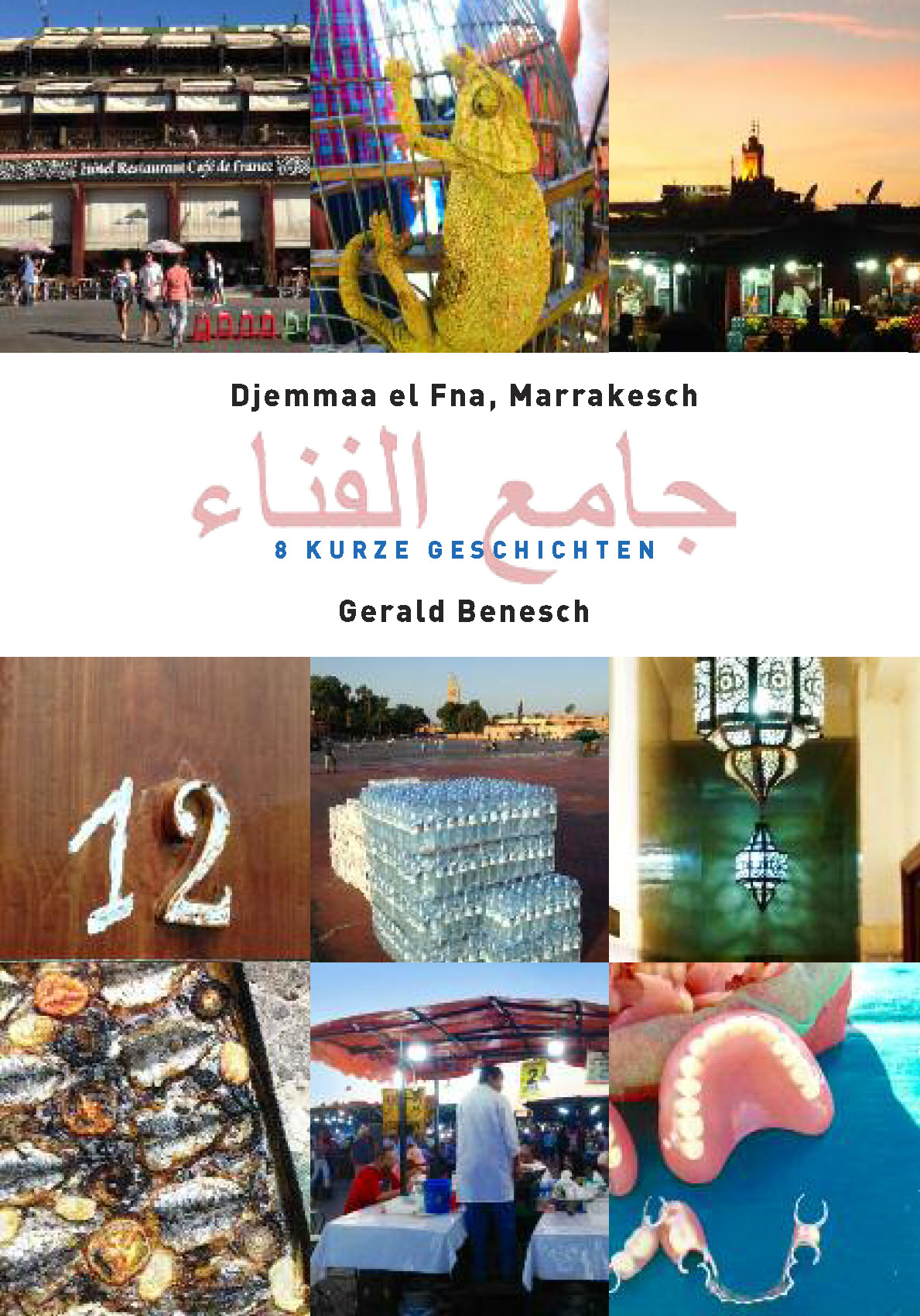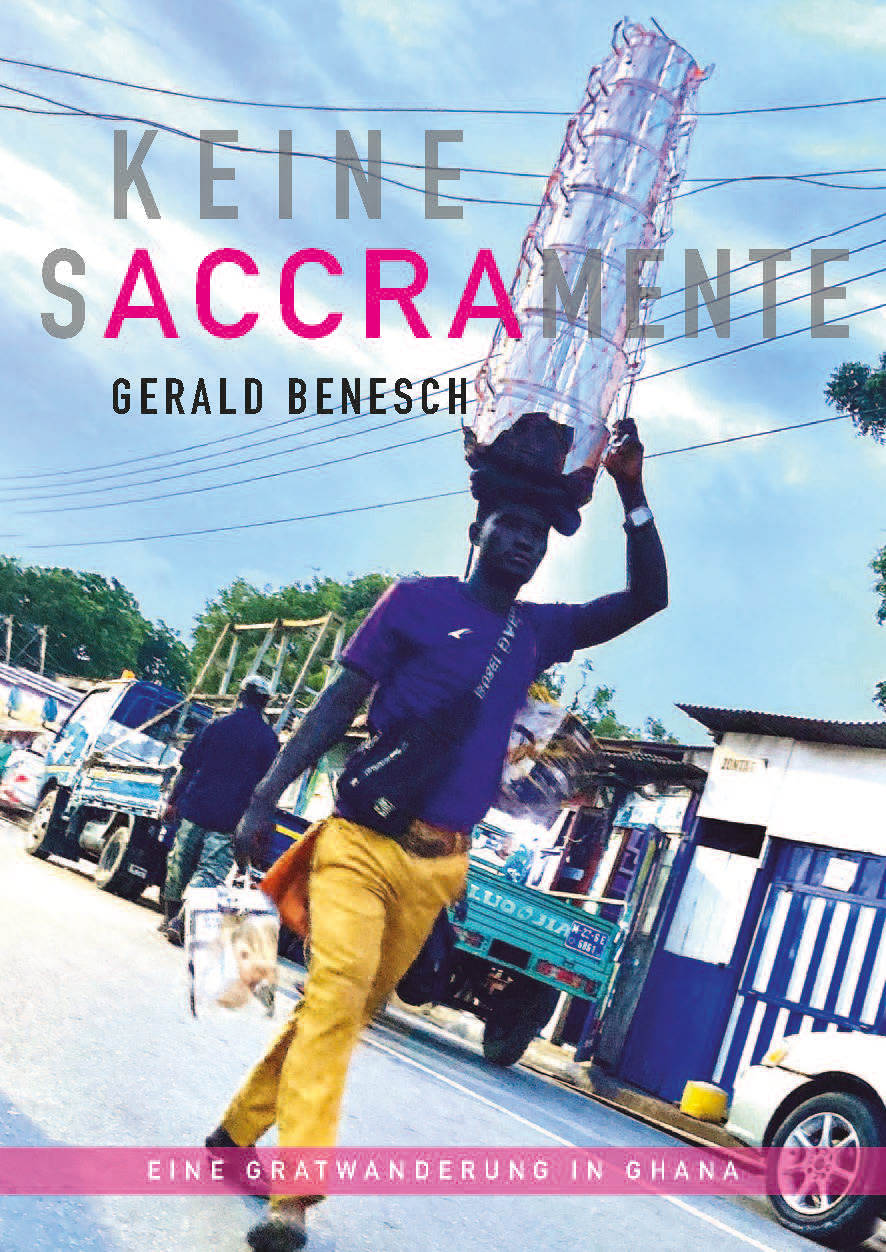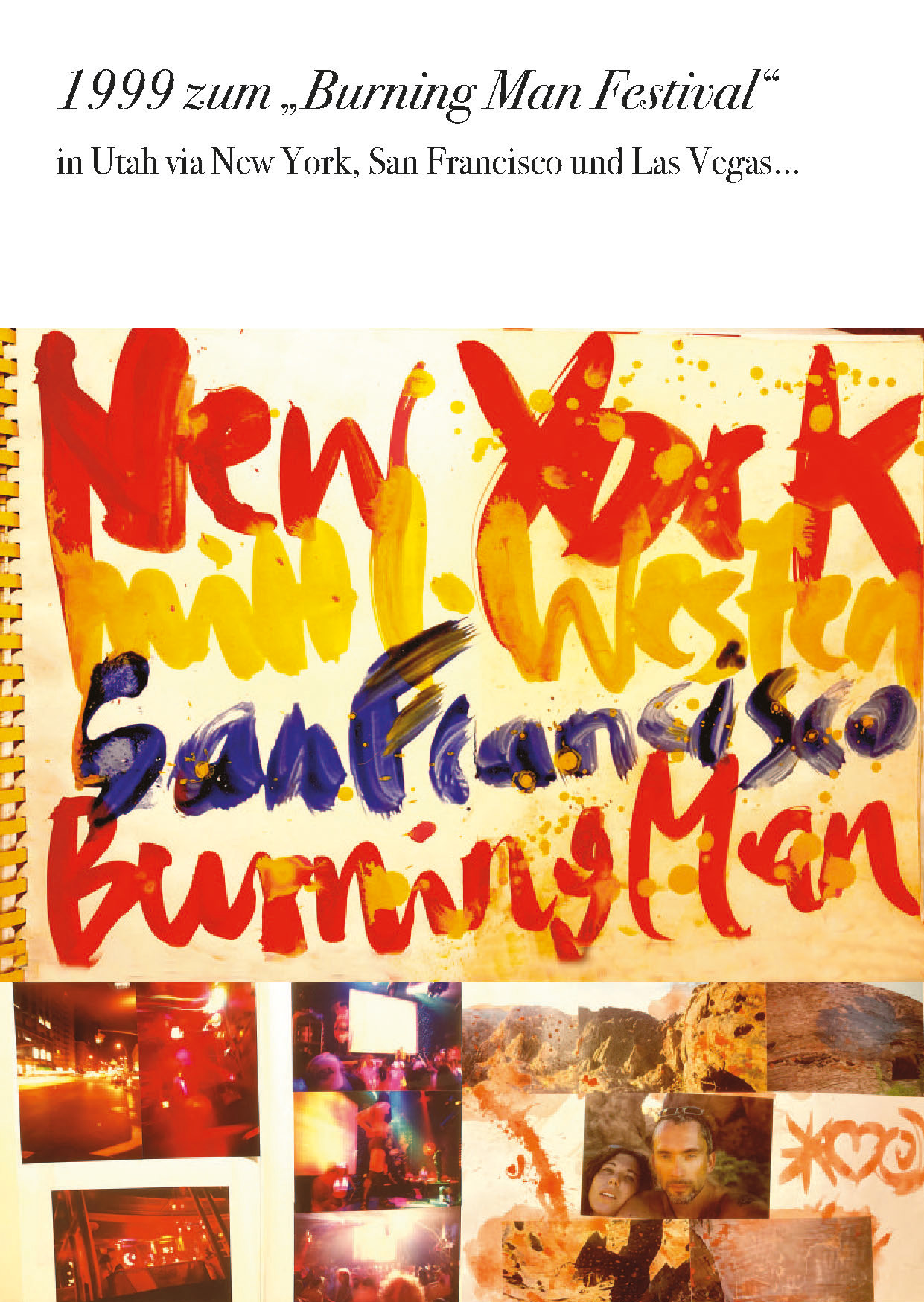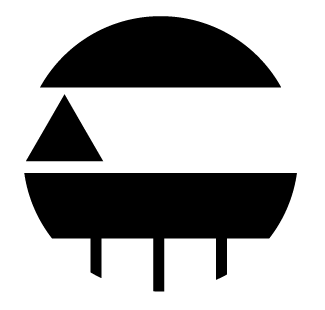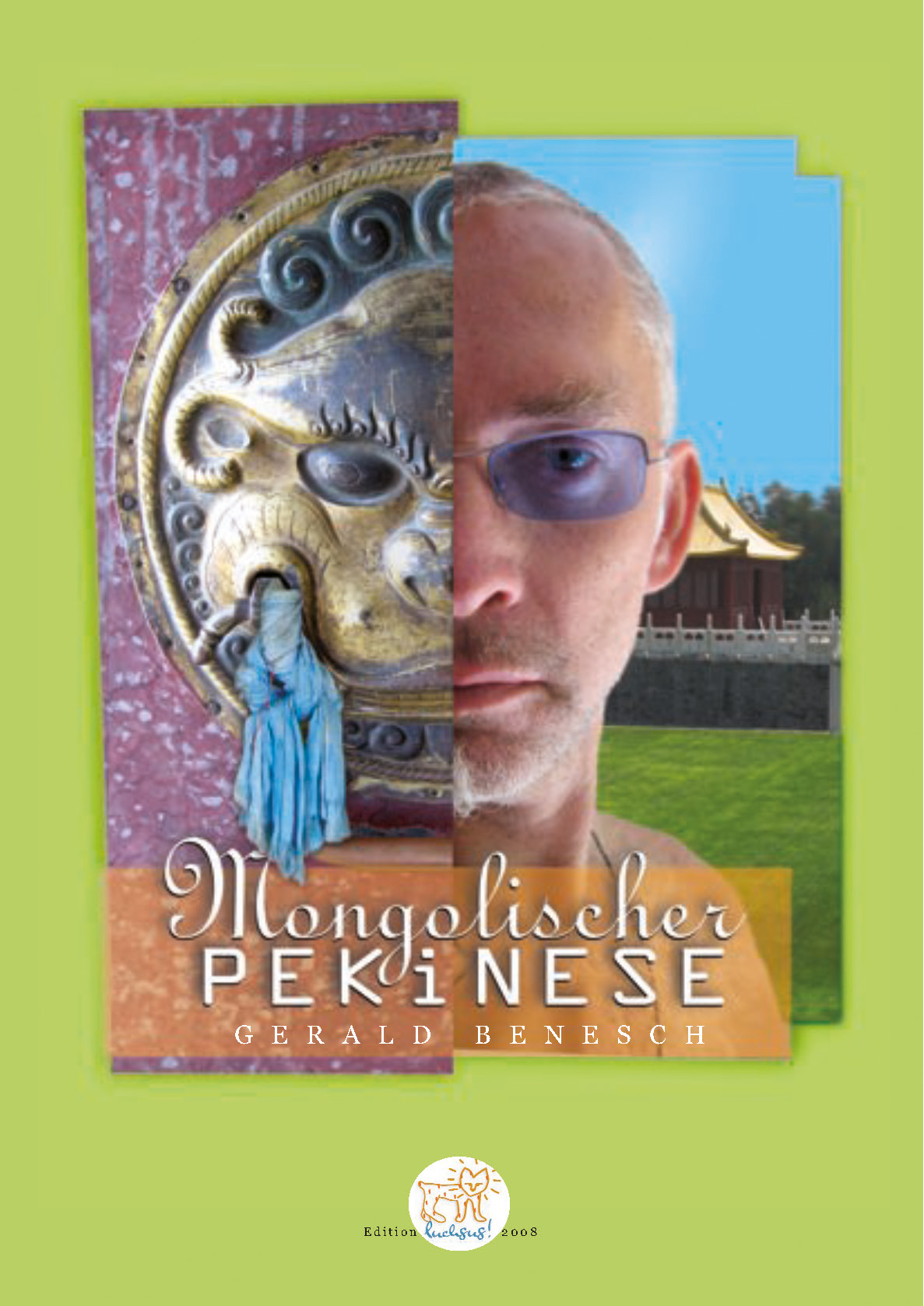
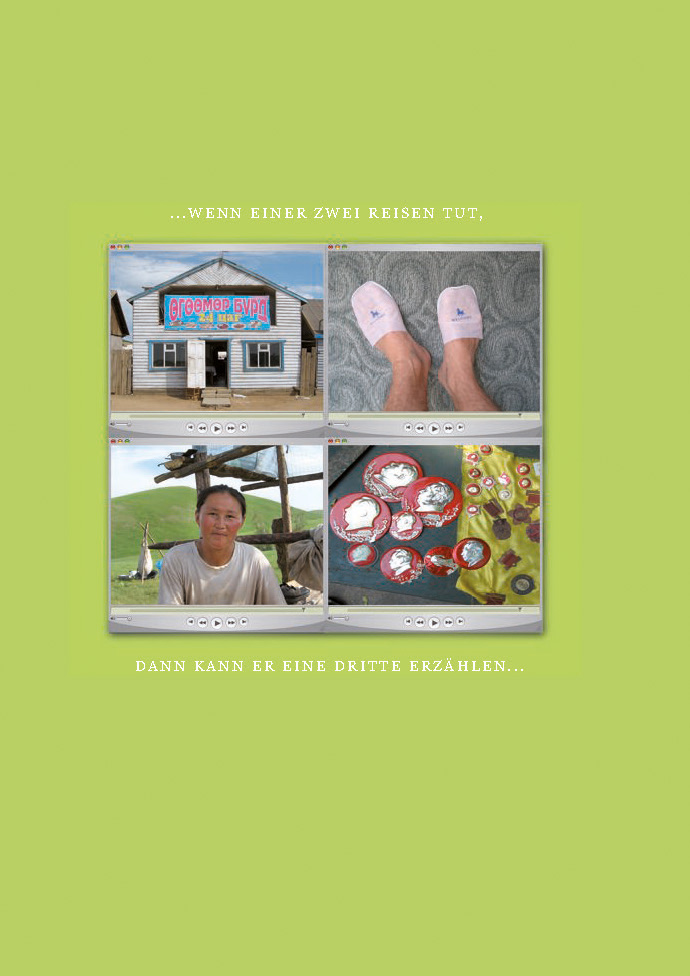
Mongolischer Pekinese
Gerald Benesch
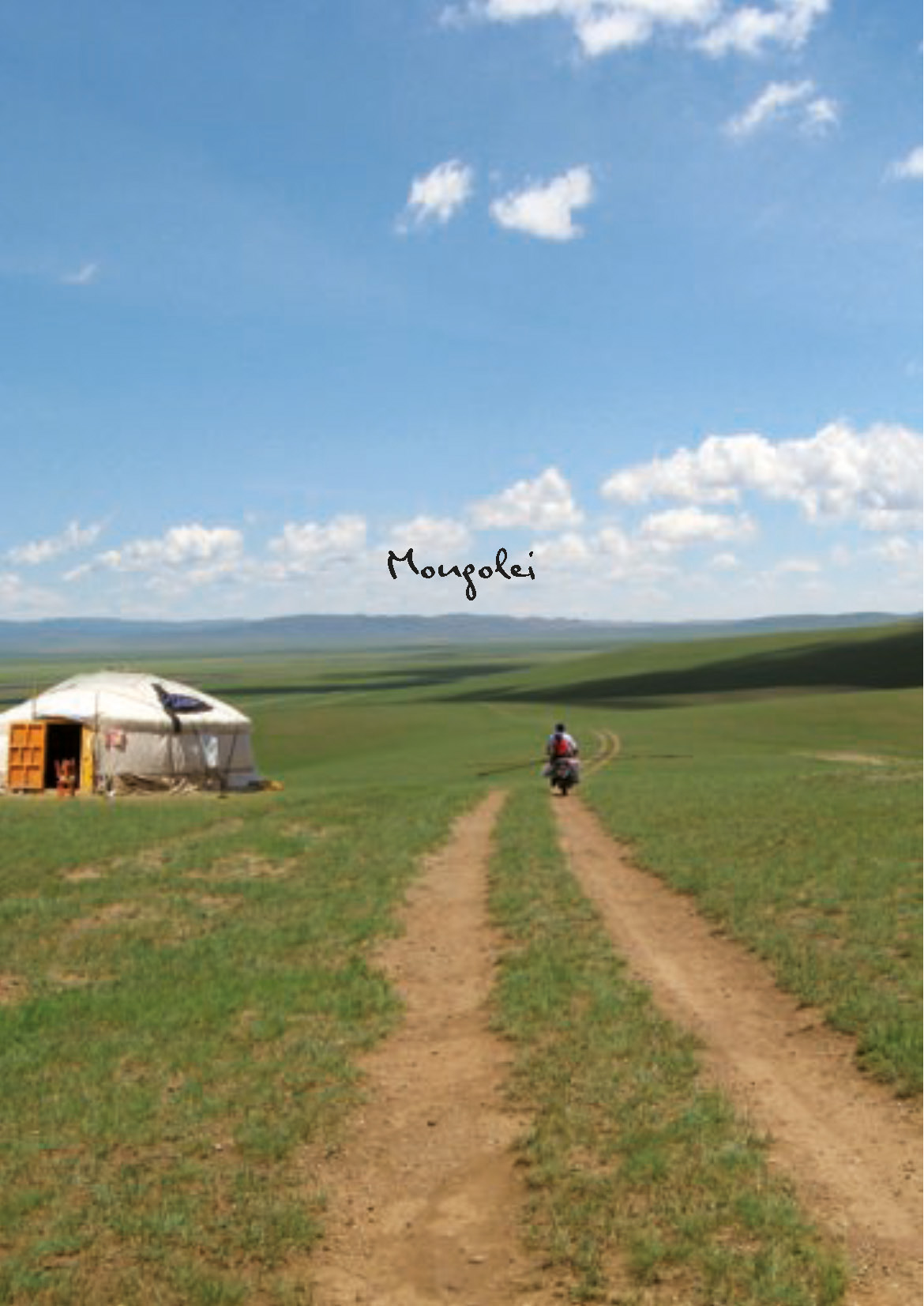
für Su, für Muttern
© Gerald Benesch
Lektorat Barbara Zwiefelhofer – BIG THX!
Typing Karin Haas , gesetzt von vaBene!schLaboratories
Gestaltung: vaBene!schLaboratories,
Coverfoto: Torgriff des Klosters Erdene Zuu, Mongolei und Tempe lim Ritan-Park, Beijing.
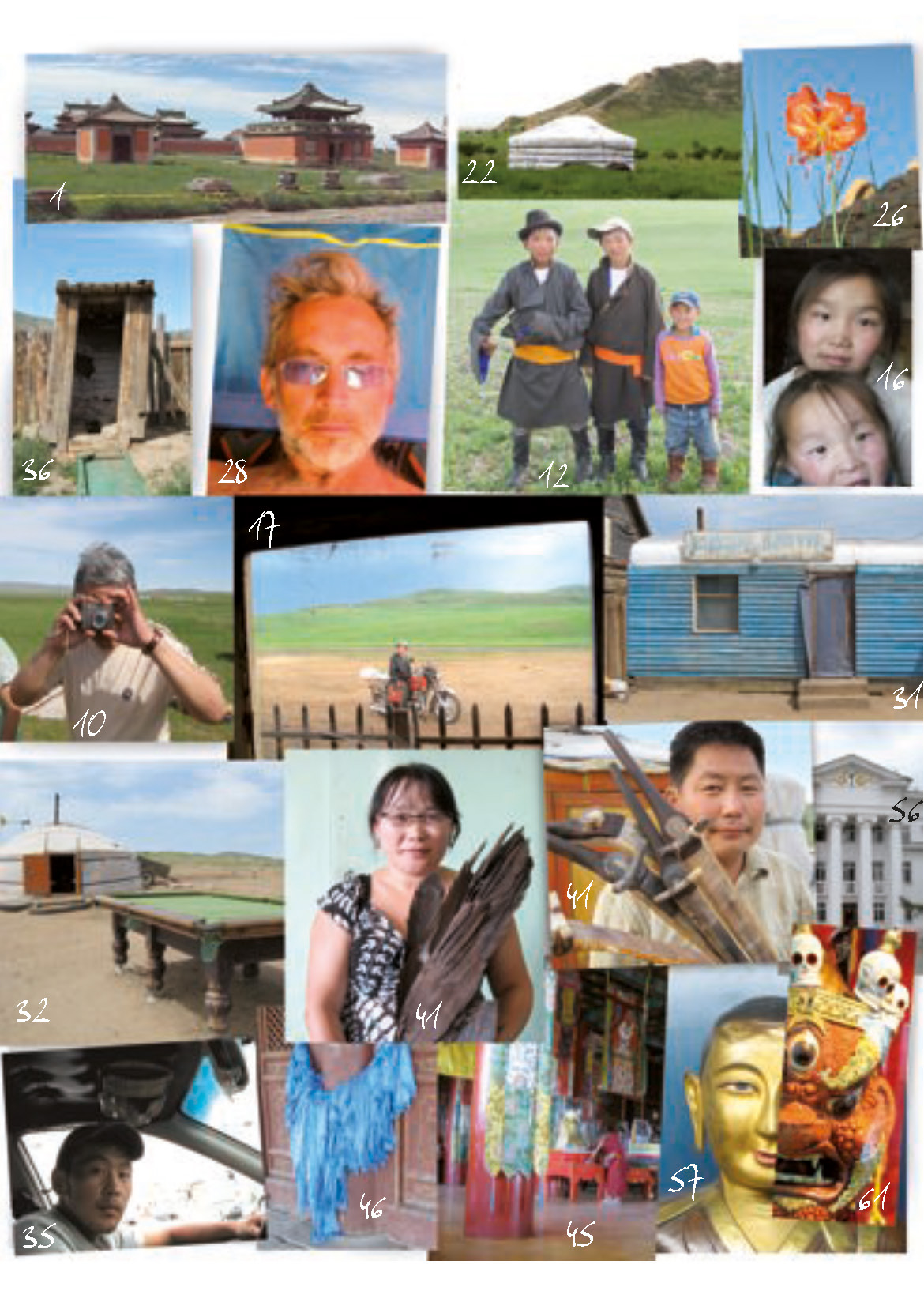

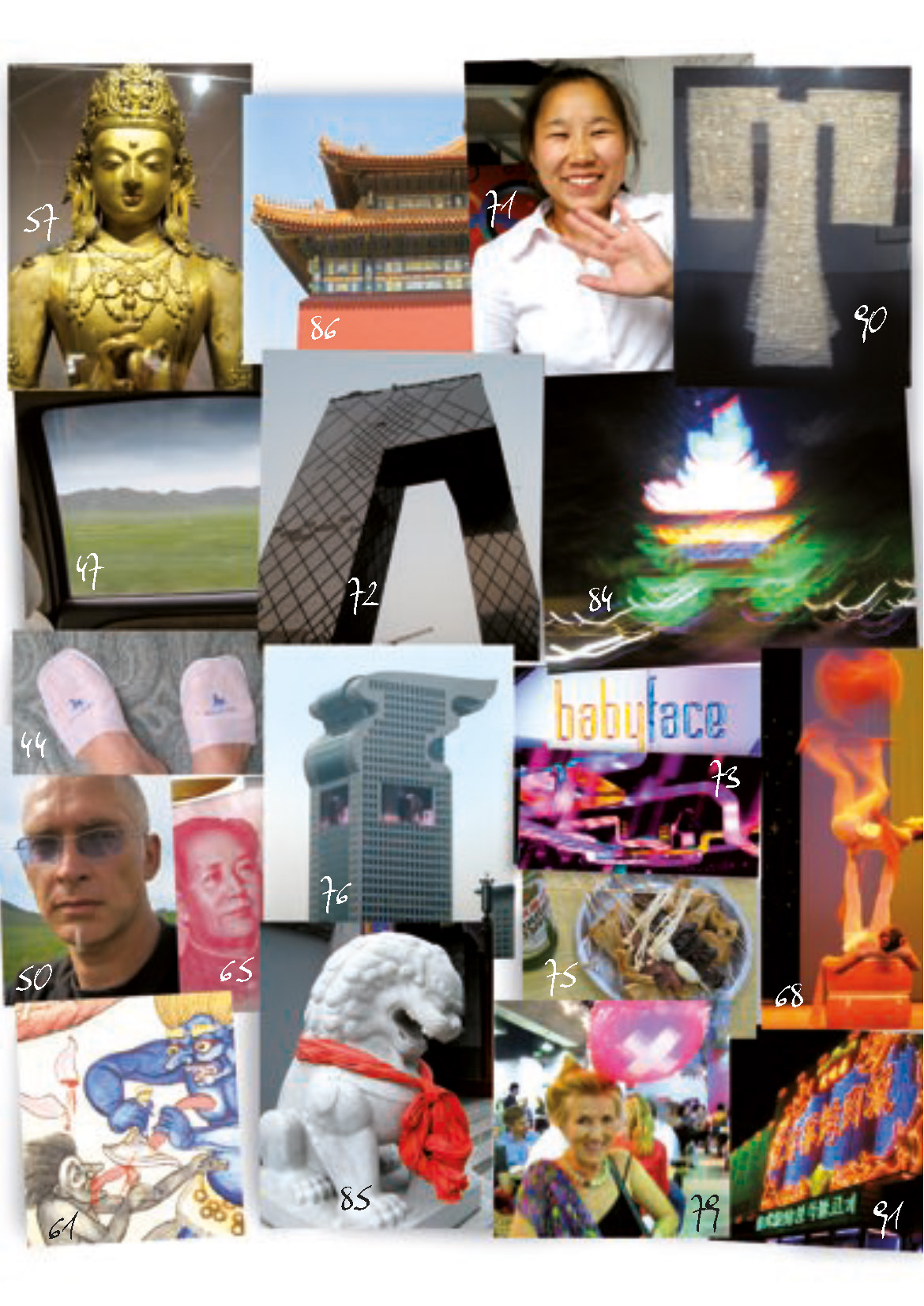

10.7.2008 – 19:30h
Panik! Im hellen Abendlicht aufwachend Beklemmung und die Nähe von Wahnsinn spürbar gegenwärtig. Gerade vorher war ich auch wach, voller Freude über die warme Helligkeit des Abends.
10.7.2008 – 16:00h
Auf der Wiese hinter den Klosterresten von Erdene Zuu beschließe ich, das zu tun, was ich vor dem Wegfahren mit „einen Travis machen“ beschrieb. Barbara wusste gleich, dass es die geradeaus durch die Wüste von New Mexico stapfende Figur aus Wim Wenders’ „Paris, Texas“ ist, die ich hier wohl meine. Ein gedankenverlorenes, gedankenloses Treibenlassen durch Gräser, Gestrüpp, quer über Straßen, eine Schrittmeditation im Großen!
Dieses Bild fiel mir wieder ein, als ich nachmittags das Nadaam-Fest verließ, die Siegerehrung der jungen Reiter auf ihren geschmückten Pferden, das enge Zusammensitzen der lokalen Honoratioren unterm Regenzelt, Frauen mit zu viel Make-up und wahrscheinlich eher chinesischen Chanel-Sonnenbrillen. Männer mit Cowboyhüten, Stiefeln und prächtigen mongolischen Mänteln. In einem arbeitslosen Dorf aus Holzhütten, inmitten von Industrieruinen am Ende der Welt. Nass die Kleidung, verkrampft das Herz, weil ein halbes Jahr Vorfreude daran zusammenbrach, dass hier in Kara Khorum Nadaam am neunten und zehnten Juli des Jahres gefeiert wird, also zwei Tage früher als erwartet und mir hier nur die verregneten Schlußmomente blieben.
1
Kein Bogenschießen, kein Ringen, nur die improvisierte Miniaturausgabe der Militärs von Letzterem, mit den hochdotierten, ins Mobiltelefon smalltalkenden Offizieren gleich hinter Erdene Zuu, auf dem Weg zum eigentlichen Festplatz. Trauer, Wut und Angst, dass der Hauptgrund meiner Reise hiermit abgehakt ist und mir 20 Tage ungeplantes Nichts bleiben, ja drohen. Ein Nichts, das vor allem darin liegt, dass die auf vielen Reisen genossene Einsamkeit plötzlich wie ein bedrohlicher Dämon immer größer in mir wird, mich an die Thangkas hier im Kloster erinnert: Dämonen gebärende und verschlingende totenköpfige Monster, eine Mischung aus rationalem Erkennen der Fakten und einem inneren Wirbelsturm der Ahnungen.
„Mach den Travis“ als innere Aufforderung, als Vorschlag zur Lösung dieses Problems der aufkommenden Leere, des drohenden Wahnsinns der Einsamkeit in einem Land, das vor allem aus Leere besteht, ab und zu ein Mongole der ziemlich sicher weder Englisch noch Deutsch spricht oder versteht. Im Badezimmer mein verstörtes Spiegelbild, ich beschließe mich mit einer spontanen Wanderung hinauf in die vom Fenster aus sichtbaren Hügel zu beruhigen, bevor es finster wird. Aus dem Hotel gehend sehe ich noch durch einen Türspalt drei mongolische Jugendliche im Karaokeraum Bier trinken, herum hüpfen, grölen – das Geräusch das mich vorhin geweckt hat.
2
Rauf zur Hauptstraße, diese querend, durch die Häuserzeilen der Vorortholzbarracken immer steiler hinauf auf diese in Fotos immer einladend weichen Hügel die sich bald als steile kleine Berge herausstellen. Vorbei an Schafherden und mannsgroßen Löchern im Grün der Wiesen, die wie Hufspuren des hier übergroß präsenten Dschingis Khan aussehen – war doch dieser Ort das Zentrum seines Weltreiches! Auf der letzten, gerölligen Etappe höre ich den inneren Motivationstrainer vorschlagen, am Gipfel etwas Beschwörendes in die ewig weite Landschaft, über den darunter liegenden Ort Kara Khorum zu rufen.
„Ich tu’ das, ich schaffe das“, brülle ich oben angelangt in die beginnende Dämmerung, eine innere Projektion von mir als Wanderer zurück in Richtung Ulan Baator verstärkend. Ich spüre den Rückzug der Dämonen, der einen heiligen Platz markierende Ovoo mit seinen weißen Pferdeschädeln, das katzenartige Krächzen der Raben und zwei Edelweiß beim Abstieg besiegeln den inneren Pakt.
Im Weitergehen passiere ich einen aus vier europäisch gestalteten Grabsteinen mit teilweise erkennbarer altmongolischer Aufschrift und drei offenen Holzsärgen bestehenden Friedhof, freistehend inmitten der grünen Hügel und bedenke bereits die Schwere meiner Aufgabe: Das oft schmerzende linke Knie, der trotz minimalem Inhalt immer noch 14 kg schwere Rucksack, die Nächtigung im offenen Gelände ohne Regenschutz – mit der Option mongolischer Gastfreundschaft in Jurten.
Aufflackernd das Kokettieren mit der Idee des minimalsten Gepäcks: in meinen Overalltaschen was ich hier bin und habe, nämlich nur Geld, Pass, Flugtickets.
Ins Hotel zurückkehrend bestelle ich ein Bier und beginne dies niederzuschreiben.
3
07.07.2008 – 8:00h
Wien, Airportbus, einchecken von Zelt, zehn Seifenblasenfläschchen – als Gastgeschenke – und Schlafsack. Vorletzter Versuch einen Kompass zu kaufen, Flug nach Frankfurt, kilometerlange Gänge von Flugsteig C nach A, Erwerb eines unlinierten Moleskinebuches mit 240 Seiten, wieder kein Kompass.
Air China 567 ist voll mit Asiaten, einigen europäischen Touristen, Businessmännern und einem gestylten Typen, der wie ein DJ aussieht – auch Peking will unterhalten werden. Diane Kiaton macht langweilige, Happy-Familymäßige Filme, die Chinesen anscheinend Remakes von US-Chartbustern: Ein dickes Mädchen wird durch eine Wunder-OP zum Model, findet keinen Gefallen an diesem neuen Leben und frisst sich wieder glücklich und fett.
So vergehen die neun Stunden, auch mit ausgiebigem Nachholschlafen, hatte ich doch die Tage vor dem Abflug mit dem Abhaken einer eher immer länger werdenden beruflichen To-do-Liste verbracht.
08.07.2008 – 6:00h
In Peking hat Lord Norman Foster einen tollen neuen Flugsteig entworfen, geformt wie ein riesiger Flügel. Einige Transitschalter-Damen schlafen, das Gepäck wird angeblich durchgecheckt, der DJ fliegt ins chinesische Ausland weiter, vielleicht braucht auch Korea coole Musik. Den Flug Peking–Ulan Baator verschlafe ich völlig, ist doch meine innere Uhr auf 22 Uhr eingestellt.
4
Nach Mitternacht – um zehn Uhr vormittags komme ich an in einem Flughafengebäude, das nach Ostblock riecht, die Schalterbeamten inklusive. „Which Hotel?“ – als ob das Beschaffen des Visums (persönliche Einladung eines Mongolen oder eines lokalen Reisebüros) nicht schon genug Zauberei gewesen wäre! Ich schlage den Reiseführer auf und nenne ihm das beste Haus am Platz.
Tatsächlich suche ich mir ein für zehn Dollar die Nacht sehr billiges, aber sehr zentral am Busbahnhof und vor allem dem Großkaufhaus gelegenes Hotel aus – zum fehlenden Kompass kommen noch der zwischen Peking und Ulan Baator verschwundene Schlafsack und das Zelt dazu. Letzteres war rein technisch eher ein Windschutz, also kaufe ich mir lieber einen Schlafsack im Armeedesign und eine gute Windjacke, dazu einen Regeschirm, Outdoor-Amateur der ich nun mal bin. Auch den relativ schweren Rucksack bedenkend freue ich mich auf die durch diese Mängel eventuell erzwungenen Zufälle der Kommunikation mit Mongolen.
Im Internetcafe noch ein paar Mails gecheckt und beantwortet, spaziere ich noch eine Weile die Hauptstraße Ulan Baators entlang, erschreckt über die vielen reparaturbedürftigen Straßen, Häuser und Gehsteige im Zentrum – und die freizügige Kleidung mongolischer Mädchen. Naja, es ist Sommer, und das nur zwei Monate lang.
Abends im Hotel schlafe ich sofort ein, werde dann aber stündlich geweckt durch die heftig trinkenden jungen Männer im Zimmer nebenan. Mehrere Schreiduelle und das Kreischen eines Mädchens später ist dann endlich Ruhe, Regen lässt die heiße Luft des Tages abkühlen.
5
09.07.2008
Der anhaltende Regen hat den morgendlichen Verkehr fast zum Stehen gebracht, ein Sammeltaxi mit der russischen Aufschrift „Markt“ bringt mich zu einem Parkplatz von wo aus die Minibusse nach Kara Khorum wegfahren. Fahren wird Oyko, aber nicht jetzt zu Mittag, sondern erst am Abend um 19 Uhr, gestikuliert er, auf seine Uhr zeigend.
Bis dahin besuche ich den regennassen Markt, der alles bietet, von der Plastiksandale bis zum ungekühlten Stück Hammelfleisch, vom Seil bis zum Puma-Fake. Ein, zwei Nickerchen später fahren wir – aber auch nur zu einem Haus hinter einem Bretterverschlag, in einer grauen Vorstadt von Ulan Baator. Dort wird der Wagen umund neu beladen und um 21 Uhr sind wir dann tatsächlich unterwegs, Oyko, seine Frau und neun Markteinkäufer auf dem Nachhauseweg nach Kara Khorum, jenem Ort auf den Ruinen von Dschingis Khans befestigtem Zeltlager.
Gleich nach der Stadtgrenze beginnt die Schlammschlacht: Die laut Reiseführer einzige durchgehend asphaltierte Straße ist von Anbeginn an nur teilweise vorhanden, die nächsten sieben Stunden döse ich, während Oyko gekonnt den besten Weg zwischen den zahlreichen Spurrinnen sucht.
10.07.2008
Um acht Uhr morgens erreichen wir das Zwanzig-Häuser- Kaff Lun, gerade mal 100 Kilometer von 360 haben wir geschafft. Die folgenden Kilometer des beginnenden Tages legen wir dann teilweise auf tatsächlich asphaltierten Straßen zurück, vorbei an grünen Hügeln, grasenden Schafen und auf der Piste stecken gebliebenen Lastwägen.
6
Mongolische Idylle und Realität pur! Zwischendurch sitzt schon mal Oykos Frau unsicher am Steuer, und prompt werden wir von einer Polizeistreife aufgehalten, Strafzahlung, weiter geht’s.
Im Halbschlaf passieren wir einen Wüstenabschnitt, drei große Stupas am Wegesrand – und plötzlich liegt die Klosteranlage von Erdene Zuu vor uns. Dass Kara Khorum gleich daneben liegt, sah auf der Landkarte nicht so aus, ich lese Oyko schnell aus dem Reiseführer den Namen des empfohlenen Hotels vor: Bayan-Burd.
Dort im beginnenden Regen eincheckend kann ich zwischen 15 Dollar Zimmern mit gemeinsamem Bad/WC und solchen um 20 Dollar mit Indoor-Bad/WC plus Kabelfernsehen wählen. Ein bisschen Luxus nach drei Tagen unterwegs gönne ich mir – ohne Frühstück um 20.000 Tügrik, also 13 Dollar. In der winzigen Hotellobby hängen die anscheinend international als Zeichen eines Sterne-Hotels geltenden drei Uhren mit den verschiedenen Zeiten. Verschieden, allerdings unbeschriftet, sind sie auch hier – allein schon weil die beiden, die eventuell London und New York darstellen sollen, nicht funktionieren.
Die erste passabel Englisch sprechende Person seit meiner Ankunft in der Mongolei ist die Rezeptionistin, der Schrecken groß als sie mir erklärt, dass Nadaam heute zu Ende geht, und nicht, wie recherchiert in der ganzen Mongolei am elften und zwölften Juli stattfindet. Sie meint, diese Daten gelten nur für Ulan Baator, am Land wäre es anders. Vier Monate Vorfreude, vier Monate der erwarteten Belohnung fürs dichte Arbeitspensum umsonst?
7
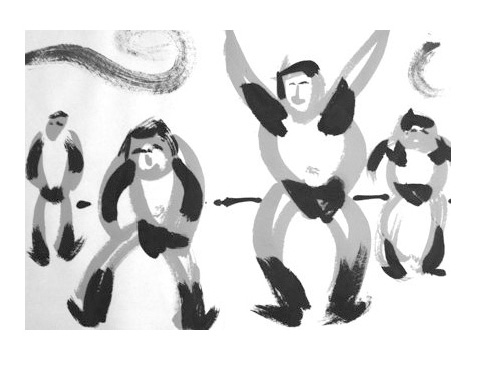
Und dann gerade noch den Nadaam-Ausklang in diesem verlassenen Nest am Ende der Welt, umgeben von Industrieruinen? Naja, mach ich halt das beste daraus, ziehe die Regenjacke an und gehe über die Felder, vorbei am alten Kloster Erdene Zuu und treffe auch den improvisierten Ringkampf von Soldaten, mitten auf der Wiese, die gockelhaft tanzenden Sieger mit nacktem Oberkörper im kalten Regen…
8
11.07.2008
Beim Aufwachen keine Spur mehr von der gestrigen Panikattacke, eher Klarheit und Freude über die gestern getroffene Entscheidung. Langsam durchforste ich den Rucksack nach Überflüssigem, finde aber nur ein paar ausgedruckte Mongolei-Google-Ausdrucke und Prospekte von der Botschaft in Wien zum Entsorgen. Zumindest passt jetzt der neue Schlafsack exakt rein, die Schaumstoffunterlage fixiere ich außen an diesem uralten Bergsteiger-rucksack, der mich schon mehrmals nach Indien und Pakistan begleitete.
Kurz vor Mittag gehe ich voller Vorfreude los ins Ungewisse! Gleich hinter der Ortstankstelle beschließe ich, wie vorgesehen, die Hügel parallel zur Straße zu besteigen und stehe schon vor der ersten Überraschung: am schlammigen Weg stehen improvisierte Verkaufstische mit religiösem und handwerklichen Schnickschnack, gleich zehn davon in einer Reihe – die Verkäufer darunter dösend. Hier im touristischen Nichts? Nein, oberhalb des letzten Tisches liegt, eingerahmt von einem Metallzaun, ein steinerner Penis, auf ein vaginales Tal zwischen den Hügeln ausgerichtet, als Ablenkung der Mönche von Gelüsten jenseits ihres Zölibates.
Schon kommt auch ein Jeep mit potentiellen mongolischen Nippeskäufern. Ich gehe weiter, die folgenden Hügel, mein Rucksack, mein linkes Knie und meine Kondition geben bereits die Wanderregeln für diesen Tag vor: 15 Minuten gehen, 5 Minuten hinsetzen und Genießen der Landschaft, die sich hier, außerhalb des Ortes Kara Khorum, sofort öffnet in grüne Hügel und Ebenen, durchsetzt mit wenigen weißen Jurten. Ich atme froh tief ein und wieder aus, erleichtert über den rettenden Entschluß und die aufkommende Leichtigkeit!
9
Einige Kilometer weiter, immer in Sichtweite der Straße, vorbei an schwarzweißen Schafherden wird meine Wasserflasche leer, und ich erreiche eine Jurte vor der gerade eine Frau die Ziegen melkt. Nach und nach kommen neugierige Kinder dazu und ein Mann um die 40, der hervorragend englisch spricht: „Sumlabatsar, Hydrologist, surface water“ sagt er erklärend und lädt mich in die Jurte ein, eine ganze Sippe von 15 Männern, Frauen und Kindern sitzt dort gesellig zusammen. Im solarzellenbetriebenen Fernseher läuft die Übertragung des Staats-Nadaam in Ulan Baator.
Davor hockt der Vater des Gastgebers und lässt mich an seinem silbernen Schnupftabbackfläschen riechen (Pfefferminz) und von den Frauen vergorene Stutenmilch kosten. Auch als Freund von sauren Speisen ist das für mich Neuland – inklusive eines heftigen, undefinierbaren Geruches, der bald in meinem eigenen Atem merkbar mitschwingt. Ein leichter Alkoholanteil ist ahnbar, und der älteste im Raum dreht an meinen Ohren, wenn ich trinke und lacht dabei. Hmm, mongolische Trinksitten…
Dazu gibt es auf einem Tablett dargebotene Käsewürfel in hell- bis dunkelgelb, wie trockener Emmentaler schmeckend. Bevor es zu weiteren Essensangeboten kommt, erkläre ich, dass ich faste, ein Ritual, das meine Reisen meist begleitet, kein Essen, nur Wasser trinkend, für acht bis zehn Tage. Vom Bier am Vorabend abgesehen bin ich also am dritten Tag, ein Plan, der neben dem Alleinegehen auch für einen modernen Mongolen nicht leicht verständlich ist.
Ohne Sippe? Ohne Hammelbraten!? Kurzes Raunen hinter mir, als ich die halbvolle Schüssel mit Stutenmilch kurz am Boden absetze (eine Respektlosigkeit!), abschließend ein scherzhaftes Digitalkamera-Duell mit Papa, auch erklärt er mir, am staubigen Boden mit einem Stock zeichnend, wo ich zum Orgon Khid-Kloster abzweigen soll: Bei den Sanddünen von Mongol Els.
Als ich winkend wie ein Westernheld ohne Pferd in Richtung Horziont weitergehe, folgt mir nach einem Kilometer ein Geländewagen, und mein Gastgeber erklärt mir auf dem falschen Weg zu sein – die Abzweigung nach Ulan Baator war auf Höhe seiner Jurte, im Winkel von 90 Grad, unscheinbar, ins Nichts führend..
10
Im Nichts ist ein Monument auf der gegenüberliegenden Hügelkette erkennbar, darauf steuere ich zu, mit voller Wasserflasche und festem Schritt. Ein Lied von André Heller aus den Siebziger Jahren beginne ich zu summen und erkenne auch bald warum: „Ein Schnitter kam gezogen, weit aus der Mandschurei, sein Lachen, das ist Thymian, sein Lieben Rosmarin, es heisst, er bringt Erbarmen für New York und Berlin“. So singt es die Kastratenstimme der Originalaufnahme in meinem Kopf, und mir fällt wiederholt der mich umgebende Thymiangeruch auf, der aber laut Reiseführer Wermut sein soll – und die Mandschurei ist ein chinesischer Landstrich östlich der Mongolei. Nach einer Ewigkeit komme ich endlich dem Monument am gegenüberliegenden Teil des Tales näher, es stellt sich als 3D-Darstellung der mongolischen Flagge heraus: in zehn Metern Höhe sind Yin und Yang, Halbmond und verbindende runde Formen aus gelben Blech, auf vier Stützen, mit Marmorplatten verkleidet, montiert. Monumentalarchitektur im Niemandsland, fern der Straße, auf einem steinigen Hügel.
Monumentalarchitektur im Niemandsland, fern der Straße, auf einem steinigen Hügel. Kaum setze ich mich völlig ermattet und durstig hin, da kommen auch schon drei jugendliche Reiter, einer davon singend, aus der Ebene auf mich zu. Tatsächlich sind es die lokalen Rowdys, neugierig darauf einen Fremden zu necken. Also wird an den Rucksack gegriffen, der Fotoapparat angegrapscht, ein paar Mal zu oft scherzhaft das Mitreiten vorgeschlagen – oder Wasserholen gegen Geld. Einer davon sieht mit mongolischem Mantel, Melonenhut und verschwitztem Haar trotzdem wie ein peruanischer Indio aus, der andere ist maximal sechs Jahre alt, mit seinen rosa Bubensandalen am Sattel, klobige Reiterstiefel an den Füßen und dem T-Shirtaufdruck „Heaven“. Der dritte ist einfach ein Teenager-Rocker als mongolischer Reiter getarnt. Ich beginne sie lesend zu ignorieren, drehe mich um. Nach ein paar Minuten reiten sie gelangweilt weiter.
11
Es ist 20 Uhr, die Sonne senkt sich, der Wind wird kühler, ich rolle den neuen Schlafsack zum ersten Mal auf, und merke gleich, dass die vermeintlich große Breite nicht zum seitlichen Liegen genügt, dass die Länge bloß ein Schlafen mit entblößtem Hals ermöglicht. Warm genug für den kalten Wind, zwischen den vier Pfeilern des Monumentes liegend dürfte er sein – bis ich mir um Mitternacht zwei Paar Socken anziehen muss, so kühl ist der Nachtwind. Mehrmals wache ich mit schmerzendem Knie auf, ohne Brille vom voller werdenden Mond unbeeindruckt. Sehr unruhig schlafend wache ich erst um halb acht Uhr wirklich auf – Zähne putzen, einpacken, losgehen.
12

12.07.2008
Die Straße ist links sichtbar, ich gehe noch zum gegenüberliegenden Hügel, zu einem anderen Monument: Drei Eisenstangen, fünf Meter lang, darauf im Scheitelfpunkt oben ein Objekt aus drei Holzscheitern mit Blechdach, an der Basis ein Steinhaufen mit einem Duzend weißer Pferdeschädel: Schamanismus und animistische Kulte versus Staat als Religion. Von Anbeginn des Tages an fühle ich mich sehr müde, das Geh-Regelwerk ist jetzt ganz klar ein anderes: 15 Minuten gehen, hinsetzen, sofortiges 15-minütiges Dösen, zäh und langsam vorbei an einer Jurte, um Wasser zu bekommen, trotz auf mich zurasendem Hund, den die Hausherrin aufhält.
Weiter, vorbei an einer Kamelherde vor blauem Himmel, das Monument noch ewig sichtbar durch meine langsames Vorankommen. Dann ein Schreck: Zwischen zwei Hügeln ist Erdene Zuu noch sichtbar, also habe ich durch die rechtwinkelige Straßenführung maximal zehn Kilometer seit gestern Mittag zurückgelegt.
13
Ein neuer, alter, abgedroschener Spruch bietet sich an als Motto dieses Teiles der Reise, „Der Weg ist das Ziel“. Ich muss ja nirgends zu einem gewissen Zeitpunkt sein, außer in 19 Tagen in Ulan Baator am Flughafen. Auch das ist variabel, ich denke auch daran, den Flug nach Beijing auf ein früheres Datum umzubuchen. Das ist aber auch schon wieder ein verschwommener Gedanke, der Weg, das angepeilte Kloster links der Dünen zu erreichen sind schon zu sehr eine begeisternde erste Aufgabe geworden! Mittags schlafe ich dann für eine ganze Stunde an den Rucksack gelehnt und wache durch die Hitze noch erschöpfter auf.
Die Wasserflasche ist leer, ich gehe zu einer Jurte, bitte um Wasser, bekomme von der lächelnden Frau Milchtee (der eigentlich gesalzenes Milchwasser mit Spuren von Schwarztee ist) und fühle mich in diesem kühlen Ger, Nadaam-Reiter im Fernsehen betrachtend, sehr bald erfrischt. Jurte kommt eigentlich vom türkischen Wort Yurt, dort “Heim” bedeutend und auf die sprachliche Verwandtschaft und geschichtliche Nähe der Völker hinweisend. Ger nennt’s der Mongole.
Einer der Söhne des Hauses blickt mit einem Mono-Fernglas bei der Tür hinaus, der andere raucht eine langstielige Pfeife, Papa und Mama sind von meinen Österreichpostkarten nicht sehr beeindruckt. Die dickliche Dame versteht meine Zeichensprachanfrage nach den Sanddünen und schreibt mir mit dem Kugelschreiber die Zahl 40 auf die Handfläche.
14
Als ich aufbrechen will, weist die Hausherrin auf die ins kochende Wasser geworfene Leber und die Därme, die gerade mit Blut befüllt werden hin. Ich lehne dankend mit einer Zwei-Finger-Marschier-Geste ab, bekomme die Flasche mit Milchtee gefüllt und ziehe munter weiter. Vorher gebe ich der kleinen Tochter vor der Jurte einen bunten Kugelschreiber und fotografiere amüsiert den Torso eines Motorrades, der radlos in der Erde steckt.
Tatsächlich gehe ich locker auf der Straße sieben Kilometer in zwei Etappen, Stangen zeigen die Entfernungen an. Unterweges bleibt ein Minibus mit drei lächelnden Mongolen stehen, ebenfalls lächelnd winke ich sie weiter – ich will gehen, nicht fahren! Kreischende Reiher im blauen Himmel begleiten mich. Über eine große Kuppe marschierend, sehe ich, dass ich bald wieder Wasser brauche und hoffe zumindest auf einen der auf der Herfahrt zwischen den Schlafphasen gesehenen Stopps mit Einkaufsgelegenheit.
Es kommt viel besser, ein perfekter Travis-Moment: Ein Holzhaus mit Bretterzaun, Windrad und buntem Schild über der Tür. Arizona könnte das nicht besser! Ein blauer Türrahmen, weißer Vorhangsstoff als Fliegenschutz, Linoleumboden, hellblaue Wände, Holzsessel, ein Verkaufspult mit Keksen, Saft und Zigaretten dahinter. Fehlt nur noch ein Cowboy oder ein Sheriff – und tatsächlich reitet draußen gerade ein Mann durchs satte Grün! Ich bestelle gleich zwei Flaschen Wasser bei der rotwangigen, zehn Worte Englisch vorführenden Tochter des Hauses.
15
Um meinen Kreislauf zu aktivieren frage ich nach Kaffee,
bekomme zwei Säckchen „3 in 1–Instant Coffee” zur Auswahl vorgelegt: „Ye-Ye” (a quality product of Singapore) und „American flavour coffee king“ (Ohne Angabe des Herkunftslandes). Dazu eine Tasse heißes Wasser und einen Löffel. Die beiden Halbliterflaschen Wasser austrinkend betrachte ich durch die blaue Türumrandung, durch das Gazenetz hindurch die draussen liegende grüne Landschaft und beschließe, hier um Unterkunft anzufragen.
Als die Geste mit gefaltenen Händen unter schrägem Kopf inklusive Schnarchgeräusch nicht klar verstanden wird, holt der muntere Teenager die zerfransten Reste eines Englisch/Russisch/Mongolisch-Wörterbuches heraus, der einzig halbwegs treffende Satz „Where is a hotel“ und der in Richtung des durch eine offene Tür sichtbaren Wohnzimmers weisende Blick machte es dann anscheinend klarer. Atemlos holt die Tochter die Mutter, eine zartere dunkelhäutigere Version ihrer selbst.
Auf meinen Schlafsack und die Couch im Wohnzimmer weisend versuche ich die Einfachheit meiner Bedürfnisse darzustellen. Die Mutter tippt in den Taschenrechner die Zahl 4000 und wir sind uns handelseinig – um wenig mehr als 3 Euro.
Ich werde weitergeführt, stelle meinen Rucksack ins Eck, setze mich auf die Couch beim Fenster und fühle mich gleich wohl in diesem Raum voller bunter Wandteppiche, holzgerahmter Familienfotos, einem Dalai-Lama-Schrein und schüchtern auftauchenden Kindern. Zwei weitere Mädchen, ca. fünf und sieben Jahre alt, setzen sich neugierig zu mir, ein einjähriger Bub stakst unsicheren Schrittes auf mich zu.
16
Alle sind sie schmutzig im Gesicht und auf derKleidung, lachend den Fremden im Wohnzimmer erkundend. Nach ein paar Minuten sind wir ein Bündel sich kitzelnder, mit meiner Schaumstoffunterlage spielender Weltkinder.
Draußen beginnt sich innerhalb von Minuten eine Wolkenfront aufzubauen, ein leichter Regen fällt, und eine Viertelstunde später zeigt sich ein aus dem Hügel gegenüber wachsender dicker Regenbogen vor dem Fenster. „Solongo“ auf mongolisch – wie ich von den Kindern lerne. Eine Stunde wird gespielt und mein Gepäck inspiziert, dann beginne ich endlich, das mitgenommene Buch anzulesen: Gerhard Roth „Labyrinth“ – wie mir gleich auffällt in seiner K&K–Kulturlastigkeit die Ergänzung zum morgendlichen André Heller. Volker gab es mir vor einigen Monaten mit der Aufforderung es zu lesen und ihm den Schluss zu beschreiben, er habe kurz vor dem Ende aufgehört zu lesen.
Schön die Widmung: „Dem lieben Gerald, das Unvollendete an sich“. Abwechselnd lese ich oder schreibe an diesem Travelogue während die Hausherrin zwischendurch die Glühbirne mit einer Autobatterie verbindet.
Das Einschlafen fällt schwer weil mein Knie schmerzt, zwischendurch bemerke ich, dass die Familie mir das Wohnzimmer komplett abgetreten hat und auf Decken am Boden des Vorraumes schläft.
Gedanken an die glückliche Wendung des psychischen Ausnahmezustandes von vor zwei Tagen begleiten mich um Mitternacht in den Schlaf, die Hausfrau ist noch am Backen von Teigtaschen.
Als ich um sieben Uhr aufstehe, war sie bereits Ziegen und Stuten melken.
17
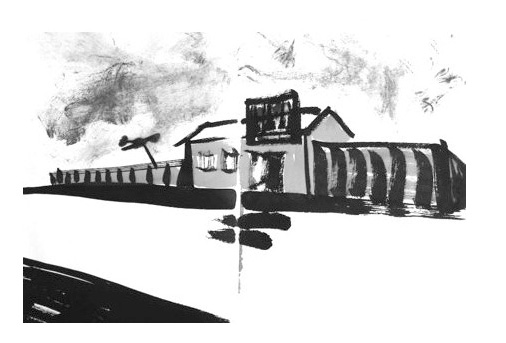
13.07.2008
Der kleine Bub erwacht, als ich hinters Haus zum Zähneputzen gehe, ich nehme ihn mit und decke ihn den Kopf streichelnd mit meinem Schlafsack zu, damit die Mädchen weiterschlafen können. Bald schläft auch er wieder und hundert Seiten des genialen Gerhard Roth-Buchs weiter sitze ich in der Gaststube, arbeite brav an meinem Wasserhaushalt und versuche, die aus der Küche kommenden Geruchsschwaden zu identifizieren: Von in Fett Gebackenem bis zur sauren Nase der vergorenen Stutenmilch.
Die einzigen Gäste dieses Morgens, drei Mongolen, setzen sich lautstark in die Gaststube und packen ihre Jause aus. Mitgebrachtes Brot, saure Gurken und fettdurchsetzte Wurst, von der Küche lassen sie sich nur Kaffee und Cola bringen. Als sie weg sind, verabschiede ich mich von der Familie – inzwischen sind zwei Burschen dazugekommen – und ziehe weiter.
18
Auf dem nächsten Hügel ein weiterer Travis–Moment: Die Straße führt mindestens fünf Kilometer geradeaus von Berg zu Berg, New Mexico lässt grüßen!
Dass mich “Paris, Texas” seit 20 Jahren begeistert, liegt an der unbestrittenen Qualität des Filmes, vor allem seines Hauptdarstellers Harry Dean Stanton, dessen Melancholie. Seit 20 Jahren haben mich die Sequenzen seines einsilbigen Wüstenmarsches inspiriert zum Bereisen von Gegenden, in denen Wüsten vorkommen, zum Suchen ähnlicher Erfahrungen, die ich dieser Methode der Fortbewegung intuitiv zuschreibe: Dem Leeren des Kopfes von überflüssigen Gedanken, dem Reinigen des Körpers durch schwitzendes, monotones Bewegen in großer Hitze.
Ich glaube diesen Moment am ehesten in einer südtunesischen Oase erlebt zu haben, konkret dem letzten Ort, den ich auf der Landkarte fand bevor nur mehr eine gelbe Fläche verzeichnet war, oder in der Weite der Wüste von Utah beim „Burning Man“-Festival.
Zurück in die Mongolei: Die ewige Gerade dauert zu Fuß mehr als eine Stunde, ein kühler Wind erleichtert den Marsch, und die nächste Kuppe offenbart eine weitere, leicht gebogene Version der eben durchschrittenen Strecke.
Auch zeigt sich hinter mir eine massive Regenfront und ich bin zerrissen zwischen dem Gedanken an eine dringend notwendige Dusche im Sommerregen und der Aussicht auf eine langwierige, langweilige Strecke mit Knieschmerzen und Mattheit nach diesem genialen Travis-Moment – und der Neugierde auf das anvisierte Kloster Owgon Khild!
Die Entscheidung wird erleichtert durch einen herantuckernden kleinen Schaftransporter.
19
Der Chauffeur und sein schlafender Co-Pilot sind unterwegs nach Ulan Baator, jedes Schlagloch langsam umfahrend, überholt von rasenden, superchiquen Landcruisern. Zuerst glaube ich, der Fahrer wüsste, wo ich aussteigen will, als wir 30 Kilometer später, nach den Sanddünen die der geographische Anhaltspunkt sein sollen angelangt sind, steige ich lieber aus – eine Schachtel Zigaretten als Dankeschön hinterlassend.
In dem Truck-Stop am Straßenrand sitzt gerade eine Gruppe junger mongolischer Männer und Frauen mit Sonnenbrillen, sichtbaren Push-Up-Büstenhaltern und Muscleshirts bei Abendessen und Wodka. Mit Gesten in die Landschaft, Lachen, Glucksen und Zeichnungen erklärt mir eine der Ladies den Weg zum Kloster, querfeldein den Straßenverlauf abkürzend, zirka sieben Kilometer zurück.
Nachdem es bereits 18 Uhr wird, beschließe ich, einfach loszugehen, bevor die Ankunft in die Dunkelheit fallen könnte. Nach einer Viertelstunde fällt mir der schwärzer werdende Himmel zur linken Hand auf, die sandtragenden Winde, Hügel überfliegend: ein Sturm! Was zuerst ein wildromantisches Naturerlebnis ist, wird in wenigen Minuten eine tatsächlich brutale Grenzerfahrung mit Windböen von sicherlich 100 km/h mit prasselndem Regen, der sich dadurch wie Hagel anfühlt, mit Blitzen in beängstigender Nähe. Letztere machen mir tatsächlich Todesangst.
Ist der Regenschirm im Rucksack Blitze anziehend? Sind die Gummisohlen mit Metalleinlage (wie mir der Mann am Metalldetektor im Frankfurter Flughafen interessiert erklärte) gut für oder gegen Tod durch Blitzschlag?!
20
Eine Stunde gehe ich so schnurstracks durch eine eigentlich wunderschöne, weiche Graslandschaft – getrieben von Angst und bald komplett durchnässt.
Mein Knie meldet sich in dieser extremen Situation zwei Stunden lang nicht – entweder durch die Adrenalinausschüttung oder durch die Kühlung des eiskalten Regens betäubt. Die Windjacke in diesem starken Wind anzuziehen ist chancenlos, ich halte sie mir seitlich vors Gesicht, die Kappe habe ich schon längst eingesteckt, der peitschende Regenwind ist einfach stärker und unerbittlich. In weiter Ferne taucht der Fuß der Khogno-Khan-Berge auf, nahezu senkrecht der Ebene entwachsend. Die Böen und der Regen werden schwächer, die Blitze ziehen mit der Gewitterfront weiter, ein leichter, wärmender Wind setzt ein, und ich kann am Fuß der Berge drei Ger-Camps ausmachen. Das am weitesten entfernt liegende erscheint mir am ehesten zum Kloster gehörig.
Nach unendlich erscheinenden zwei Stunden erreiche ich, nachdem ich monumentale rundlich-rote Steinhaufen als äußerste Ausläufer des Gebirges passiert habe, um 20 Uhr ein vielzeltiges Ger-Camp, sichtlich voll mit Touristen. Zwischendurch war mir der Bezug zwischen Kloster und brutalem Gewittersturm als Wortspiel in Form eines buddhistischen Prinzipes eingefallen: „Ich nehme Zuflucht im Buddha“. In einem festen Haus erkenne ich Mongolen in der Küche stehend und frage nach dem Manager.
Es erscheint eine Frau um die 40, die es bevorzugt Deutsch mit mir zu reden! Nachdem ihr Camp voll ist, erklärt sie sich bereit, mich ein Tal weiter zu fahren – alleine schon, um mich unterwegs nahezu ungläubig nach meinem Alleingang und dem Fasten (heute ist der fünfte Tag) auszufragen.
Auch im Camp gleich um den nächsten Gebirgsausläufer herum ist eine Frau der Manager, Ehemann und Sohn Batbold nur Helfer.
Die sechs Gers sind besetzt von einer im Gemeinschaftshaus lauthals feiernden Gruppe Engländer, Batbold bringt mich im durch die Einrichtung klar erkennbaren Privat-Ger der Familie unter. Dalai-Lama, trocknendes gelbes Joghurt in einer Tonschüssel und ein mehrmals nachts auftauchender Igel umgeben meine Nacht im Schlafsack.
21
14.07.2008
Morgens lese ich den immer schräger werdenden Gerhard Roth, als ein klappriger PKW mich abholt zum Umzug in einen der klinisch reinen Touristen-Gers – eine halboffene Dachluke mit Plastikfolie als Regenschutz, blitzblaue Kunstseide als Innenverkleidung, zwei neue, der Rundung angepasste verzierte Betten, dicker, wasserabweisender Filz unter der weißen Außenabdeckung.
Hier beginnt sich die Anstrengung der letzten Tage bemerkbar zu machen: Ich döse und schlafe bis Mittag, Gelenksschmerzen erinnern an das durchnässt Herumlaufen gestern Abend, das Knie meldet sich beim seitlichen Liegen, der Kopf ist leer und voll zugleich. Am frühen Nachmittag steige ich unter großer Anstrengung die wenigen Schritte entlang mannsgroßer Gesteinsbrocken hinauf zum Kloster, links ein zerfallener Lehmbau größeren Ausmaßes, oberhalb zwei kleine chinesisch angehauchte Häuschen mit einer großen Gebetsmühle und einem Meditationsraum voller bunter Thangkas und einem Buddha im Glaskasten.
22
Weiters drei Stupas, ein Gebetshaus, ein Touristenshop und oberhalb das Wohnhaus der Mönche, die gerade in Ulan Baator sind, um das Nadaamfest zu besuchen. Mir fällt nacheinander das Schneiden meiner Haare mit einer Küchenschere ein, in einem Kloster auf Sri Lanka, die Abbildungslosigkeit Buddhas bis ins fünfte Jahrhundert, also tausend Jahre nach seinem Tod, die Verschiedenheit der Darstellung vom asketischen bis zum fetten Buddha, die Importierung des Buddhismus aus Tibet in die Mongolei – erweitert um einige lokale schamanistische Anteile.
Interessiert beobachte ich eine Gruppe von zwölf Touristen, die gerade angekommen sind. Einige davon könnten genausogut vor San Marco in Venedig stehen, scherzend, das nächste Café suchend, andere haben Expeditions-Outfits und Riesenkameras, einer scheint aus der Philosophievorlesung gerissen worden sein.

23
Mein „Handbuch Mongolei“ erklärt auch das Irritiertsein der Mongolen mit Individualreisenden – also mit mir – damit, dass bis zur Ablösung von der UDSSR ab 1992 nur Gruppenreisende, gut führbare Genossen aus Russland oder der DDR, als Touristen üblich waren, und die boomende Tourismusbranche ab den späten 90ern dieses Prinzip übernahm. Folglich stellen die meisten Botschaften nur Personen mit persönlichen Einladungen durch Reisbüros (also Vorabbuchungen) oder durch hochoffizielle Privatpersonen Visas aus.
Diese Paketbucher sieht man dann in Convoys von zwei bis vier Geländewagen oder in schnuckelige, alte russische Kleinbusse gepfercht herumkutschiert werden. Next Stop: Red Cliffs – in 14 Stunden. Nein Danke! Das reicht sogar so weit, dass die nette Micky, Besitzerin eines kleinen mongolischen Reisebüros, die mir Katja aus Bonn als Helferin in der Visanot empfahl, meinte, ich könne ohne Jeep und Driver nicht aus Ulan Baator hinaus.
Und wie machen es die Mongolen? Fliegen die auf Adlers Schwingen!? Adler – und andere Großvögel – gibt es hier überall, im besten Fall hier am Gebirgsrand über mir kreisend, schlimmstenfalls von einem Herren im Dschingis-Khan- Outfit vor Erdene Zuu fürs Erinnerungsfoto bereitgestellt.
Der Nachmittag ist abwechselnd sonnig-heiß (da krempelt man einfach die Jurtenverkleidung hoch) oder leicht regnerisch – ich verdöse ihn großteils, zwischendurch besuchen ein Erdhörnchen, ein Vogel und eine kleine Kröte die Jurte.
Der Abend zieht sich endlos lang, ich bin zu schwach/zu schmerzbeeinflusst um zu erkunden oder zu wandern – lese lieber Gerhard Roth fertig, um Platz zu schaffen für Vivekanandas „Raja Yoga“, passend zum klaren Kopf des Fastens und seit drei Jahren für so einen Moment aufgespart, nach dem Erwerb im indischen Wallfahrtsort Vrindaban. Um 22 Uhr schlafe ich endlich ein und erwache um acht Uhr mit stärkeren Kreuz- und Gelenkschmerzen als gestern – und fast schon an Übelkeit grenzender Schwäche.
24
15.07.2008
Elektrolyte! Ein salziger Tee im leeren Gemeinschaftshaus ist der passende Muntermacher, Batbold liest gerade eine mongolische Zusammenfassung westlicher Wissenschaften, von Sokrates bis Descartes und Einstein. Ich schmunzle, was wären diese gewesen ohne die arabische Zahl Null, ohne die Erkundungen Alexander des Großen bis vor die Tore der von Wissenschaft gefüllten Städte Delhi und Samarkand…
Heutige Mission: Besuch des ursprünglichen, zerstörten Klosters Owgon Khild. Die Bauten hier am Talende heißen Erdene so wie der große Vierkanter in Kara Khorum. Der von meiner Ger-Managerin „Baissa“ Baysgalan empfohlene Bergpfad am Talende erscheint mir zu steil, ich will – in dem Glauben, dass die Ruinen von der Ebene aus erreichbar sind – diese sanftere Variante beschreiten.
Leider auch, da ich erst um zehn Uhr erst weggehen, die heißere. Zwei weitere Taleingänge erkunde ich bis zwölf Uhr, dann drehe ich ermattet um, immer wieder die Ähnlichkeit der Gegend mit der von Utah oder New Mexico vergleichend – auch mit deren Schönheit!
25
Den Nachmittag verbringe ich dösend und Vivekananda lesend. Um 17 Uhr beschließe ich, der Einladung der Managerin, die ich am vorgestrigen Abend im Nebental ankommend traf, zu folgen.
Die Abkürzung über einen kleinen Bergrücken ist beeindruckend: Riesige rötliche, runde Steinformationen, einzelne mannshohe Felskugeln auf Flächen ruhend erinnern mich wieder an „Buddhas Butterball“ in Tiruvanamalai in Südindien. Orchideen und Nelken entlang des gerölligen Weges, der eher ein Pfad von Schafen und Ziegen zu sein scheint. Blaue margaritenartige Blumen. Unterwegs ein Steinbockgehörn an einen Baum gelehnt, dutzende weiße Skelettteile in einer dunklen Höhle, die sich öffnende Ebene.
Nara, Managerin des Khogno-Khan-Camps steht cool eine Davidoff-Zigarette rauchend auf der Terrasse hinter dem Küchenhaus ihres Ger-Camps. Die Auslastung ist hundertprozentig in diesen Tagen, Reisegruppen wechseln täglich, buchen brav Reitangebote und Wanderungen. Das Essen ist zur Hälfte mongolisch und europäisch betitelt, beides vermutlich in den Vorstellungen vom Geschmack der Touristen angepasster Form: in der Küche wird gerade eine Flasche Rotwein geöffnet und in Likörgläser verteilt.
Seit 1995 ist sie die Chefin hier von Mai bis Oktober, den Rest des Jahres erledigt sie Verwaltung oder ist auf Urlaub. Nara strahlt die Selbstverständlichkeit einer europäischen Businessfrau aus, spricht sehr gut Deutsch und dirigiert ihr Personal während wir uns unterhalten.
26
Wir reden über den gerade aufgehenden vollen Mond, der im mongolischen kein spezifisches Geschlecht hat. Interessiert hört sie, dass in den meisten europäischen Sprachen der Mond weiblich ist, nur im Deutschen männlich. Auch ist sie erstaunt, dass irgendetwas an diesem Himmelskörper romantisch sein soll. „Gar“ der Mond „Nar“, die Sonne lerne ich.
Nara(!) hat sichtbar Spaß an den Stories meines Individualreisens in ihrer Heimat, scheint meine Aversion gegen Schleppertourismus insgeheim zu verstehen. Wie auf ein Stichwort erscheint eine rundliche mongolische Dame in Hot Pants und erklärt der aus der Speisesaal-Jurte kommenden Gruppe im perfektem Französisch den Rest des Abends und den morgigen Aufbruch.
Nara schlägt vor, mich übermorgen um ca. neun Uhr abzuholen und zum nächsten Dorf zu bringen, mein Weiterkommen nach Ulan Baator zu organisieren. Frohgemut bis euphorisch (typisch für die letzten Fastentage) gehe ich pfeifend wie John Wayne in einen lilaroten Sonnenuntergang nach Hause.
Mit diesen erfreulichen Aussichten schlafe ich, die kommenden Tage planend, ein: Übermorgen in Ulan Baator in einem guten Hotel absteigen, stundenlang duschen (ich hab’ seit einer Woche nicht mehr), Wäsche waschen, TV-glotzen – und genüsslich wieder zu Essen beginnen, zum Beispiel mit einem kleinen Obstsalat! Weiters: zu Mittag auschecken, klären ob Air China meinen Flug nach Beijing auf den 24./25. vorverlegen kann, zum Markt fahren und einen der Minibusse für die Markteinkäufer – diesmal Richtung Norden, nach Darchan – nehmen.
Von dort sind es nochmals 70 Kilometer nach Dulaanchaan um Herrn Bolbatar zu besuchen, einen der drei mongolischen Bogenbaumeister. Das ist mein persönliches Nachholen des Nadaam-Festes, zumindest des für mich interessantesten Teiles!
Überhaupt, was für ein lasches Ereignis ist das mongolische Nationalfest geworden – das Zerschmettern des Rückgrates eines Rindes mittels Faustschlag wurde gestrichen, Männer tragen beim Ringen offene Jäckchen weil einst eine Frau sich unter die Sieger geschwindelt hatte – und das von Dschingis Khans Truppen erfundene Polo kam nie in die engere Auswahl, der Ball war der Kopf eines getöteten Feindes…
27
16.07.2008
Ich wache vor sieben Uhr auf, weil mein Knie im Liegen schmerzt. Kaum aufgestanden, ist der Schmerz sofort weg, ich mache mich fertig, um den eigentlichen Weg hinauf zum Kloster Owgon Khild zu gehen, ein zerfranster Schafsteig, steil vorbei an Felsbrocken, an einem Bächlein, an von Insekten zerfressenen und dadurch gefällten Birken.
Nach 90 Minuten mit vielen Ruhepausen (ich sollte im aktuellen Fastenzustand wohl eher über den Kosmos meditieren als heftig zu wandern) erreiche ich ein Hochplateau, eine Alm voller Gräser, Kräuter und Blumen. In der Mitte stehen die vier bis fünf zerstörten Hauptgebäude des Klosters, 200 Mönche sollen hier gelebt haben, bevor 1939 die stalinistisch–kommunistische Führung im Rahmen der landesweiten „Klärung der Lamafrage“ es ebenfalls schleifen liess.
Unvorstellbar, hier in dieses Paradies herauf zu klettern, um ein Kloster zu zerstören! Die absolute Perfektion, Ruhe und Abgeschiedenheit dieses Ortes laden mich dazu ein, auf einem Felsen sitzend Vivekananda zu lesen.
28
Raja Yoga ist einer von mehreren Wegen des Yoga, bei uns im Westen ist ein anderer, Hatha Yoga, fälschlicherweise für das Ganze stehend, der bekannteste. Vivekananda macht sich über diese körperfixierten Gesundheitsapostel lustig: „So, if man lives long he is only a healthy animal“. In dieser Zusammenfassung historischer indischer Texte des Raja Yoga geht es um „conquering the internal nature, clearing of the mind“ – gerne wüsste ich, was die tibetisch beeinflussten Lamas hier oben praktizierten.
Jedenfalls war das eine der vielen Klostergründungen des ersten großen buddhistischen Führers namens Zansabar, Bogd Gegeen betitelt, einer anerkannten Wiedergeburt eines hohen tibetischen Lamas hier in der Mongolei. Er wurde im 17. Jahrhundert von Lhasa aus beauftragt in seinem Heimatland missionarisch tätig zu werden. Nach einigen Reinkarnationen empfahl man diesem Bodhisattva auch als Mongole wiederzukommen. Leider war das dann eher eine Kette von kurzlebigen, unzüchtigen, alkoholsüchtigen, jähzornigen, prunkgierigen Wiedergeburten, beendet durch diejenige des 1924 verstorbenen Bogd Khan der sich sogar zum Staatsoberhaupt ernennen ließ – wenn er nicht gerade verschwenderisch lebte! Der aufkommende Kommunismus, die Unterdrückung von Religion verhinderte die Auffindung seiner Folgeinkarnation.
Die beginnende Hitze lässt mich wieder den Weg ins Tal suchen, im Ger zwei Stunden genüsslich träumend dösen. Die Hitze verstärkt sich in für mich bisher ungewohntem mongolischem Maße, sogar die spezielle Gerventilation hilft nichts mehr. Schreibend und lesend verbringe ich den Nachmittag nackt und matt auf einem der Betten liegend.
Der abendliche Vollmond steigt hinter einer Bergflanke auf, umgeben von Wolkenschnörkeln, irgendwann nachts steht er über der Dachluke der Jurte, scheint für mich.
29

30
17.07.2008
Das schmerzende Knie und der kühle, helle Morgen treiben mich um sieben Uhr aus dem Bett, bei einem salzigen Tee führe ich ein Gespräch mit Baissa über den schlechten Geschäftsgang ihres kleinen Camps – ich verspreche ihr ein Foto– und Textpaket zu mailen zum Weitersenden an die E-Mailadressen von deutschen und mongolischen Reiseveranstaltern, die sie gestern aus meinem Merian- Magazin herausgeschrieben hat.
Sie bringt mich hinüber zum Khogno-Khan-Camp, um Nara den Weg abzukürzen, die uns dann aber auch schon entgegenkommt, mich durch die immer wieder erstaunliche Schönheit dieser weiten Landschaft zum nächsten “Truckstop” bringt. Ein anderes Wort dafür fällt mir nicht ein, sieht es hier doch komplett wie im amerikanischen Mittelwesten aus: Tankstelle, einige holzverkleidete Diners, davor allerdings Jeeps und Kleinbusse.
Trucks, fällt mir gerade auf, im Sinne von Transport-LKWs habe ich noch fast keine gesehen, außer kleine, alte. Wie transportiert man Lebensmittel, Baustoffe etc. von Ulan Baator nach z.B. Kara Khorum? In einem der Diner an einen Tisch eine Dame größeren körperlichen Kalibers, umgeben von einer Traube Mädchen im Alter von sieben bis siebzehn Jahren, zwei davon in blauen Gilets mit spitz zulaufenden Krawatten, einer Fetisch-Schuluniform nicht unähnlich. Etwas seltsam wirkt das, in Verbindung mit diesem Ort, mitten in der ländlichen Mongolei.
31
Dann wiederum: Im TV über der Saftbar läuft gerade „Mongolia Supermodel 2008“ – mit genauso hübschen Mädchen wie denen hier im Lokal!
Nara spricht einen Mann in einem Minibus an, der uns versichert, mich in einer Stunde abzuholen, und nach Ulan Baator mitzunehmen. Nach fast zwei Stunden kommt er wieder, dem Landesbrauch entsprechend, gilt es aber erst den Wagen zu beladen und zu betanken. Dann folgt eine Performance, die mich wieder fast in die Nähe des Wahnsinns bringt: Dieser Fahrer überholt andere Autos, um danach langsamer zu fahren als vorher, mehrmals glaube ich an einen Motorschaden, nein, er lässt nur den Wagen fast komplett ausrollen!
Bemerkenswert ist auch sein Monotasking: Spricht die Mutter mit Kind am Beifahrersitz ins Mobiltelefon, so wird er – zuhörend – automatisch langsamer. Allgemein wird in der Mongolei viel telefoniert und jeder Anruf angenommen, in seinem Fall auch dann, wenn er eigentlich eher eine dritte Hand bräuchte beim Bewältigen der Buckelpiste vor Ulan Baator. Unfassbar, im Vergleich wäre von Wien bis St. Pölten, also 100 Kilometer, nur eine große Grasfläche mit mindestens sieben Spuren, kreuz und quer, bei Regen nahezu unpassierbar – unsere Regierung müsste zurücktreten. Oder ein bis zwei Minister müssten gehen. Hier nicht, man kauft sich einen Landcruiser und los geht’s – entsprechend ist die Luft in Ulan Baator im Winter zum Schneiden, begünstigt durch die Beckenlage der Stadt.
Die um 40 Prozent erhöhten Spritpreise von 2007 liessen die Vier-Rad-Euphorie dann wieder abflauen.
32
Voller Extreme ist diese Stadt, mehr als die Hälfte der Bewohner hat als Option oder alleinige Wohngelegenheit eine Jurte, ein Jurtengürtel umrundet das Zentrum, durchsetzt mit meist eher sommertauglichen, einfachen Holzhäuschen. Außerhalb liegen dann wieder Jurten, abwechselnd mit Villenvierteln der Reichen, natürlich mit noch mehr Landcruisern.
In solch einem Jurtengürtel-Vorort laden wir aus und Mister Superdriver bringt mich ins Zentrum. Auf der Buckelpiste vorher war er dann plötzlich eine Offenbarung, auch wenn mir dabei klar wurde, dass ich das Paket „Drei Wochen im Geländewagen durch die Mongolei“ niemals buchen werde!
In Vorfreude auf die kommenden Tage miete ich mich im nach dem berühmten Kloster benannten “Hotel Amarbayas Galant” ein. Das Hotel ist ein wunderbarer Mix aus 70er Jahre, Art Deco und Buddhismus. Ja, das geht tatsächlich, um 40 Dollar inklusive Frühstück mit Schokoriegel am Teller, jeweils einem Schälchen löslichen Kaffees und Milchpulver, mit einem gerahmten Poster der Mona Lisa über die Schulter blickend!
Und österreichischer Streichkäse anstelle von Produkten der mehrheitlich vierbeinigen, milchproduzierenden Bevölkerung der Mongolei stellt das Frühstücksbufett dar. Am Abend fahre ich aber noch schnell mit einem öffentlichen Bus ins bereits bekannte Großkaufhaus mit der Las-Vegas-artigen Neonschrift „State Departement Store“, um eine Nagelschere und Einwegrasierer zu erstehen – und im Supermarkt um die Ecke eine folierte Reisrolle die sich Sushi nennt.
Im Internetcafé lese ich, dass Su den Stress und die Verwirrung bei meiner Abfahrt gut verdaut hat, mich noch liebt.
Im Hotel beginne ich dann mit dem Waschen aller Kleidungsstücke bevor ich mich mit einem mongolischen Bier aus der Minibar und der Sushiwurst ausgestattet selber in die Wanne lege und beginne mich abzuschrubben. Ah, ein richtiges, weiches Bett und MTV-Asia – was für ein perfekter Abend!
33
18.07.2008
Vormittags, nach dem Frühstück mit Mona Lisa, schreibe ich noch, zappe durchs Kabel und nehme mir danach auf der Hauptstraße eines der herbeiwinkbaren Privatautos, welche hier die Taxis sind. Im Fernsehen waren gerade noch Lamas live aus Ulan Baator beim Chanten – sehr hypnotisch und vermutlich fünf Strassen weiter aufgenommen!
In diesem verbeulten Wagen sitzt ein coolen, harten, mongolischen Hip-Hop hörender Bursche am Steuer, sehr aggressiv und listenreich immer die schnellere Spur fahrend. Die Adresse des Air China Büros sagt ihm nichts, da ruft er sofort einen Freund wegen Details an. Leicht finden wir das Gebäude, ich verlege meinen Beijing-Flug auf den 26.7. vor, wir holen mein Gepäck vom Hotel und der Bursche weiß dann auch gleich, an welchem staubigen Ende der Stadt der Bus nach Norden, nach Darchan abfährt.
Ulan Baator hatte bis vor kurzem keine Straßennamen und dazugehörige Hausnummern, sondern Viertel mit markanten Gebäuden als Orientierungshilfe, auch keinen Postzustelldienst! So wohnte man dann „zwei Straßen nördlich des Polizeireviers von Sansar, das 25. Haus, ein gelbes“.
34
Der Fahrer ist ein Profi auf seine Art, und vermehrt fällt mir mindestens eine weitere Filmreferenz ein. Dieser Cultureclash innerhalb dieses Landes, die tätowierte, grinsende Version eines Taxilenker: Das hat etwas von Blade Runner, von Mad Max!
Knapp erreichen wir den öffentlichen Bus, der vier Stunden auf guter Straße für die 200 Kilometer braucht, für die mongolischen Mitfahrer unterhaltsam gestaltet durch DVDs der hiesigen Löwinger-Bühne – für mich eine lautstarke Slapstick-Tortur. In Darchan, einer Stadt, die von Leichtindustrie und Gemüseanbau lebt, ist die Stimmung sommerlich leicht an diesem lauen Freitagabend.
Der Buschauffeur erkennt trotz Sprachbarriere mein Dilemma hier wegzukommen: Er findet für mich die bäuerliche Version eines Taxi-Punks, der mich nach Dulaankhan, dem Dorf des Bogenbaumeisters Boldbattar bringt. Eine typische Internet-Zufälligkeit auf ihn zu kommen: Auf Google unter „archery, mongolia“ suchend war ich auf den Blog eines Kanadiers und Bogenschützen gestoßen. Namen und Dorf des Meisters nennend – ohne Erwähnung einer Telefonnummer oder einer anderen Kontaktmöglichkeit. Auf die mongolische Gastfreundschaft und sein Interesse an der Exotik eines interessierten Besuchers aus Europa hoffend hatte ich beschlossen, es einfach zu probieren, einfach hinzufahren.
Wunderschön ist die Reise übers Land, vorbei an Kamelherden, Teichen, abendlich picknickenden Mongolen mit PKWs an den seltsamsten Plätzen schräg an den Hängen der Hügel geparkt. Timbaland-Remixes und epische mongolische Sänger aus dem Radio als Soundtrack dieses noch stärker als sonst wohlduftenden Szenarios – stimmig!
35
Was mich zuerst empfängt, sind Myriaden von Moskitos, einige Menschen laufen mit Imkerhüten oder Tücher schwingend von Haus zu Haus, eigentlich erbärmlichen Bretterbuden, eine davon angeblich Wohnhaus und Werkstatt des Bogenbaumeisters.
Menschen, die ich anspreche, rasen Unverständnis gestikulierend weiter, ein Mädchen in urbanem Adidas-Outfit (Unterwegs, auf einer Raststätte saß ein Mann im Lokal, auf dessen Sportanzug, am Rücken stand ADIDASS) weiß die Frau von Boldbattar im Geschäft um die Ecke.
In ein weißes Tuch gewickelt, mit riesiger Sonnenbrille, den voluminösen Oberkörper in einen Diet-Coke-Sweater gewandet, nehmen sie und der Englisch sprechende Cousin, der auf Urlaub hier ist, mich gleich mit. Wenn man in diesen Stunden vermutlich schon die ersten von Touristen gemachten Aufnahmen des Staats-Nadaams auf YouTube sehen kann, ja manche Reisen und Aspekte eines Landes durch diese geniale Filmchenbibliothek an einem Abend nachvollziehbar sind – vieles hier Erlebte ist selbst mit Worten, Fotos und Filmen nicht beschreibbar.
Allein schon der Moment, als wir uns wie Diebe blitzartig durch einen Schlitz der mit Filz grob abgedämmten Eingangstür schleichen und versuchen die Millionen von Mückenmonster nicht herein zu lassen. Tatsächlich, eine mückenfreie Zone tut sich auf in Form einer europäisch eingerichteten, leicht schmuddeligen Küche.
Die Brote mit Mayonnaise und frischen Kräutern oder örtlicher Sauerkirschmarmelade schmecken köstlich nach dem Stress des Ankommens an einem weiteren Ende der Welt.
36
19.07.2008
Bayarmaa ist anscheinend die Managerin ihres Mannes – aber auch sein handwerklicher Partner in der Produktion der Bogen und Pfeile. Mit einer Tasse Tee in der Hand gehen wir in die der Küche angeschlossenen Werkstatt, ein in diversen Schattierungen komplett türkis gestrichener Raum, in der Hitze des Abends Kühle – und vor allem ein eigenes Königreich darstellend. Hier sind auf drei Tischen diverse Materialteile der einzelnen handwerklichen Abschnitte aufgelegt.
Ein Tisch voller Bögen in der finalen Phase des Bemaltwerdens, des Beklebens mit Birkenrinde oder Schlangenhaut, ein Tisch voll mit Hörnern von Steinböcken deren Anschnitte mit Hitze gerade gebogen eine der drei Komponenten des Bogens ausmachen.
Verbunden mit einem Körper der aus zusammengeleimten Sehnen besteht, sowie Bambus, ergibt sich die gewünschte Mischung aus Elastizität und Steifheit. Allerdings brauchen die einzelnen Schritte so viel Arbeitsaufwand in der Produktion und Zeit für die Trocknung, dass ein Bogen ein halbes Jahr bis zur Finalisierung benötigt, und die Trockenphasen bevorzugt in den Winter gelegt werden.
Die Pfeile wirken dagegen wie Stiefkinder: Von der Drehbank kommen die Birkenrohlinge, diese werden mit Sandpapier feingeschliffen, bekommen beschnittene Geierfederhälften mit Leim aufgeklebt oder auf Wunsch auch in Rillen des Schaftes versenkt. Die Nocke am Pfeilende ist meist aus Horn und als Keil eingesetzt.
37
Das Vorbereiten der Geierfedern, das Aufkleben und andere Zulieferarbeiten tätigt an diesem Samstag eine Helferin aus dem Dorf, während der Woche sind zwei Lehrlinge hier tätig. Nach einer moskitofreien Nacht auf dem Boden des an die Werkstatt angehängten Info-Büros der örtlichen Microbusiness-Gemeinschaft (Marmeladen, Tischlerarbeiten, Bayarmaa hat hier eine leitende Funktion genauso wie sie einen Karton voller Medikamente und Erste-Hilfe-Materialien als medizinische Ansprechperson des Dorfes hütet) gibt es ein mongolisches Frühstück.
Tee, Brot mit Mayonnaise und Johannisbeermarmelade, sowie ein undefinierbares Stück Fleisch, gekocht am Knochen. Gleich danach geht Bayarmaa an die letzten Produktionsschritte einiger Bögen die nächste Woche mit Boldbattar nach Deutschland fliegen sollen – er fährt mit einem englischen Begleiter auf eine Tournee zu einigen Bogensportvereinen, um seine Produkte zu präsentieren. Malend, klebend, die Assistentin bei der Pfeilproduktion unterweisend verbringt Bayarmaa den Vormittag mit mir und dem übersetzenden Bayar, immer wieder ihren Ehemann anrufend, der seit gestern Abend bei einer Feier verschollen ist – und nicht abhebt. Zwischendurch wird auch mal der Dorfschamane angerufen, für ein eventuelles Treffen mit mir, das nicht zustande kommt.
Nach dem mittäglichen Suppentopf mit Wildzwiebeln und Fleischstückchen lege ich mich auf einen Haufen Lederflecken, die zur Köcherfertigung bestimmt sind und reflektiere die verbrachten Tage hier in der Mongolei: Ein Szenario aus äußeren und inneren Landschaften, sich verdichtend und wieder ausbreitend, eine Kette an letztendlich schönen Momenten, die vor dem Abflug – wie immer auf meinen Reisen – nicht geplant, nicht absehbar sind.
38
Dann wiederum: Momente, die mir als glücklich, einzigartig einfallen, mögen für andere eine Qual sein, ein unprogrammiertes Chaos. Für mich hatte der zu gehende Weg der ersten Tage die gleiche Qualität, Schönheit und Wichtigkeit wie die abenteuerliche Reise hierher ins Ungewisse eines Dorfes an der russischen Grenze, 200 Kilometer südlich des Bajkalsees. Ein Nickerchen später holt mich Bayar mit einem Jugendfreund in dessen alten, klapprigen Mercedes ab, um eine Runde durchs Dorf zu fahren, für Bayarmaa einzukaufen und einen örtlichen Künstler in seinem eigenen Museum zu besuchen.
Vor einem V-förmig gebaute, ebenerdigen Holzhaus mit großen, dreiteiligen Fensterflächen steht ein Mann mit langen weißen Haaren und einem Cowboystrohhut. In der Hand hält er ein kleines Trinkglas mit klarer Flüssigkeit, Wodka. Die Türe an der Spitze des „V“ öffnend offenbart sich ein Kuriositätenkabinett – voller obskurer Holzobjekte – gepaart mit einer Galerie.
Hier reihen sich ausgestopfte Wildtiere, Fische neben gewundenen Wurzelstücken, die Schlangenköpfe geschnitzt bekamen, anderen Wurzelteilen die zu Kobolden zusammenmontiert wurden, zu Affen. Einige Uraltfotos von Schneehühnern und Füchsen, den Künstler mit geöltem, schwarzem Haar sowie einige großformatige Landschaftsgemälde komplettieren das Potpourri.
39
Der alte Mann geht uns den Weg zu einem ausgetrockneten Bachbett vor und bleibt an einem mannshohen Stein stehen, in den ein Buddha gemeißelt ist – ein Jugendwerk von ihm, umgeben von Bäumen voller blauer Tücher. Jetzt bekommt das Wodkaglas einen Sinn (außer es eventuell unterwegs auszutrinken à la „Don’t leave the house without it“) – er spritzt einen Teil davon mit den Fingern auf das Buddhabild im Stein, den Rest auf das trockene Bachbett:
Es soll sich wieder füllen, so wie in seiner Jugend hier am Berg. Was der betagte Künstler und sein Leben hier repräsentiert ist die spirituelle Symbiose welche die Mongolei ausmacht: Ursprünglicher Animismus, Schamanentum, die Verehrung des Himmels als „blaue Mutter“ wurden in zwei Etappen mit dem tibetischen Buddhismus vermischt. Wenn dort Gelb die primäre Farbe ist, so ist es hier das komplementäre Blau, leuchtend von den Steinhaufen und Bäumen, die dadurch als „Ovoo“ gekennzeichnet sind. Hier genauso als Schnittpunkte zwischen Buddhismus, Animismus und Schamanismus: Lamas oder Schamanen bestimmen, wo die Ovoos angelegt werden. Der alte Künstler verbrennt Plastiksäcke mit Müll als wir zurück in die Werkstatt fahren, wo bereits der Vater von Bayar auf uns wartet – und noch immer kein Boldbattar.
Ein Männchen sitzt auf einem Hocker und beginnt mich sofort mit direkten Fragen zu bombardieren: Wie ich, auf welchem Wege ich in dieses Dorf gekommen wäre, warum ich reise, wo ich es besonders schön fand, ob ich die Mongolei für sicher halte. Die letzte Frage entlarvt den pensionierten Dorfpolizisten, scherzend zieht er ab, um seiner Frau beim Einkochen der Marmelade zu helfen.
40
Nach einem kurzen Gang zum Kaufhaus nebenan zurückkehrend heißt es: „Er ist da, er schläft aber!“. Wie an einigen bisherigen Momenten dieser Reise denke ich mir, das wäre doch eine schöne Fotostory, und schlage Bayarmaa vor, sich mit dem großen Geierflügel fotografieren zu lassen: Inszeniert wie eine Renaissance-Madonna auf der Titelseite der Vogue, wenn auch auf einem Holzschemel sitzend.
Die Zeit für die Fahrt zum Bahnhof drängt, eigentlich wollten wir alle im Zug sitzen, aber durch Boldbattars Verspätung geht sich das nicht mehr aus. Also fotografiere ich den erwachten aber sichtbar noch nicht nüchternen Bogenbaumeister mit einem Bündel seiner Bögen im Arm wie einem stolzen Feldherrn vor der Jurte des Nachbarn und stelle mittels Bayar noch ein paar technische Fragen.
Boldbataars Vater und Großvater waren große Schützen auf den Nadaams, der Großvater baute sich Bögen und Pfeile noch selbst, Boldbattar lernte es von einem der letzten großen Meister des Landes. Offiziell bauen diese Art von Bögen in dieser Perfektion nur noch er und zwei Meister in der Nähe von Ulan Baator. Ich verspreche ihm, einen Bogenschützenclub in Österreich per Mail von seiner Reise nach Europa zu informieren, vielleicht laden sie ihn ja ein. Gemeinsam schlürfen wir noch eine Nudelsuppe, Boldbattar saugt laut schmatzend aus den darin liegenden von ihm mit der Hand aufgebrochenem Knochen.
Mit Bayar und seinem kleinen Sohn geht es auf der Ladefläche eines LKWs durch Wolken von Moskitos zum Bahnhof, der sich tatsächlich als Station der „Transsibirischen Eisenbahn“ herausstellt: Der einfahrende Zug hat fast nur Liege- und Schlafwagen,
41
adrette Zugbegleiterinnen, die auf Anfrage Wasser für Tee oder kaum genießbaren Löslichkaffee in kleinen holzbetriebenen Öfen am jeweiligen Waggonanfang kochen, im Rest der Welt ein unvorstellbares Sicherheitsrisiko, hier ganz normal. Auf der mit einem dünnen orientalischen Teppich bedeckten Sitz- und Liegfläche seines reservierten Abteiles erzählt mir Bayar noch von seiner Frau, die jetzt für ein halbes Jahr in den USA ist, um ein Wirtschaftsdiplom abzuschliessen, während er seinen Job bei einem der 14 mongolischen Fernsehsender als Redakteur hat, tagsüber unterstützt von einem Kindermädchen für den Buben.
Darchan, die nette Plattenbaustadt, die zweitgrößte der Mongolei mit ca. 90.000 Einwohnern, erreichen wir nach ca. einer Stunde, ein Taxi bringt mich zum angeblich besten Hotel der Stadt, „Ulintchin“. Die Eingangshalle hat den Charme eines Bankfoyers, das Stiegenhaus kann durch das abgegriffenen Holzgeländer nicht darüber hinwegtäuschen, dass hier mit Marmorplatten ein spätkommunistischer Zustand zugedeckt werden sollte.
Zimmer 313 könnte jedoch genauso auch in einem Flughafenhotel in Frankfurt oder Chicago sein, stimmige, kontinentalneutrale Einrichtung inklusive MTV-Russia, MTV-China und dem internationalen Kinokanal HBO auf der Fernbedienung. Eigentlich ein perfekter Kontrast zum Mückeneldorado Dulaankhan und für 25 Dollar wohlfeil.
42
20.07.2008
Zum Frühstück: Eierspeise, zwei Scheiben Wurst, graues Brot, Mayonnaise und Himbeermarmelade, der obligate flaue Löslichkaffee. Es ist ein Sonntag, die Straßen sind leer, die Geschäfte geschlossen, Bars mit Footmassage sind das einzige Angebot, um etwas zu konsumieren – und ein Friseur! So wie die Sehnsucht nach Leere auf meinen Reisen oft in die Nähe von Wüsten oder anderen entlegenen Gegenden führte, so sicher war auch meist der rituelle Haarschnitt ein Teil davon. Eine richtige Sammlung von skurrilen Erlebnissen tat sich da zusammen: Hongkong, Pakistan, Madagaskar, Sri Lanka, Nevada – immer wurde der Friseur an den ersten Tagen aufgesucht, der Akt oft als symbolisches Abschneiden einer Last empfunden. Am schrägsten fiel das Ergebnis in Segou, in Mali aus: Schwitzend versuchte ein junger Mann mit den Techniken die er für gekräuseltes Haar vermutlich sehr wohl beherrschte, sich an meinen Haaren.
Immer wieder standen einige heraus, die er mutig bis verzweifelt wegschnippste – bis er am Schluß diese europäischen Besonderheiten nur mehr mit Sprühern aus der Wasserflasche und feuchten Fingern unterdrücken konnte. Der Haarsalon hier aber bestand aus zwei Damen, die mit „Schwarzkopf“–Umhängen sehr professionell aussahen, und es auch waren. Mein grauer Haarschopf wurde binnen Minuten mit dem Rasier-Trimmer auf praktische fünf Millimeter gekürzt, etwas grob vielleicht, aber effizient und unter den lachenden Augen weiterer Kunden.
Das eigentliche beste Haus der Stadt, das „Hotel Darchan“ ist leider komplett ungepflegt, hier lebt der real existierende Kommunismus weiter, inklusive völlig zugewachsenem Garten und leerem 80er-Jahre-Fitnesscenter.
43
Darchan heißt „der Schmid“ – mit diesem Namen sollte bei der Stadtgründung 1961 das Programm definiert werden: Ein großer metallverarbeitender Industrieklotz am Ortseingang ist der Hauptarbeitgeber, die damalige UDSSR hat tatkräftig mitgeholfen mit Plattenbauten für die Arbeiter und einer „Allee des Volkes“ zum Flanieren nach Feierabend. Die hohen Sympathiewerte des ersten Eindruckes von vor einigen Tagen bleiben erhalten, als ich am frühen Abend eine Runde ums Hotelviertel spaziere: Gemütlich beim gerade schließenden „Black Market“(!) sitzende Menschen in sommerlicher Kleidung, ein Schwätzchen mit dem Nachbarn, Frauen die Chiffonkleidchen tragen oder über engen Jeans ihre mongolischen Speckröllchen zeigen – genauso wie Männer das T-Shirt hochkrempeln um in der sommerlichen Hitze ihr rundes One-Pack zu lüften.
Abends ist es dann ein Genuss in das weltumspannende Kabelnetzwerk von HBO einzutauchen: Nette Filme, um es sich in der geschmacksneutralen kleinen Welt meines Hotelzimmers bequem zu machen, einfach mal das Rollo runterlassen und auf Urlaub sein von der Mongolei, Steve Martin und der großartige Robert Downey Jr. helfen dabei.
44
21.07.2008
Dafür ist dann der Kulturschock umso größer, als, wie bestellt, um acht Uhr der Fahrer da ist, um mich zurück in die Mongolei, zum Kloster Amarbayasgalant zu bringen. Ein hier leistbarer Luxus, mich um ca. 60 Dollar in dieser Toyota-Limousine durch weite Täler, entlang kleinen Flüssen und durch sich teilende Meere von Schafen und Pferden chauffieren zu lassen. Als Untermalung dazu gibt es mongolische Popmusik, ein Sound, der an epischer Breite und groß angelegter Melodieführung der Landschaft entspricht und jeden Eurovisions-Songcontest gewinnen würde!
Da der junge Chauffeur die Abfahrt auf die Schotterstraße zum Kloster versäumt, schenkt er mir unfreiwillig eine Stunde mehr des luxuriösen Gleitens durchs weiche, unendliche Grün. Teilweise etwas ruppiger geht es dann 25 Kilometer inklusive zweier kleiner Flussdurchquerungen (Der Fahrer steigt zuvor aus, um zu klären ob der Wagen durchkommt) zum vom ersten Bogd Gegeen, dem buddhistischen Führer, Ende des 17. Jahrhunderts gegründeten Kloster.
Inmitten einer großen Ebene dann dieses Juwel der mongolischen Religionsgeschichte, erbaut im chinesischen Stil – also Pagoden mit Drachenköpfen, glasierte Keramik, rote Flächen. Kein einziger Tourist, aber mongolische Großfamilien bestimmen das Bild gemeinsam mit Scharen von jungen Mönchen, vor allem im großen Zeremonienraum. Ein Raum, der leicht mit einem Krawatten-Showroom der Sonderklasse verglichen werden könnte: Von der Decke, an den einen Meter dicken Holzsäulen hängen bunt ornamentierte, spitz zulaufende Seiden- und Brokatstreifen.
Überall, besonders verdichtet im Lichtschacht oberhalb der Litaneien betenden Mönchsschüler. Zwischen sechs und 16 Jahren alt sitzen sie in zwei Reihen auf der Achse Eingang und Allerheiligstes. Sie lesen, rezitieren zum Teil auswendig, während ein älterer Mönch mitbetend lehrerhaft auf und ab geht.
45
Er scheint radikale Lehrmethoden zu verwenden: Als er seine zarte Holzkette schwingend einen unaufmerksamen Schüler zurechtweist, zuckt dieser zusammen, andere nutzen den Zeitpunkt, wenn der Lehrer vorbei gegangen ist, um zu schwätzen, scherzhaft zu boxen. Auch hier wieder das spirituelle Mix: Eine Frau mit straff zurückgekämmtem Haar in einen blauen, verzierten Festmantel gewandet lässt in Spendenbuch beim Eingang ihren Betrag vermerken und opfert ein Fläschchen Wodka am Schrein mit der Wachsnachbildung des ersten Bogd Gegeen. Von diesem gibt es hier im Raum mehrere Darstellungen – von einer Mme.
Tussaud-Variante über gemalte Thangkas bis zu fast schon abstrakten Figuren, eine davon erst 50 Jahre nach seinem Tod seinen mumifizierten Korper einschließend. Zanabasar, so sein eigentlicher Name, hat nämlich diesen Ort als letzte Ruhestätte seines physischen Körpers gewählt, die nächste Reinkanation fand bereits ein Jahr später statt. Zu seinen vielen Tätigkeiten zählt auch die Erfindung einer rituellen Schrift, das Fertigen von Bronzeskulpturen, der Entwurf des immer noch verwendeten Staatswappens, das Gründen von Klöstern und die Verbreitung des tibetischen Buddhismus – letzteres in derart flächendeckendem, wachsendem Maße, dass es bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts 750 Klöster gab, ein Drittel der männlichen Bevölkerung als Lamas tätig war!
Eines der von Zanabasar gegründeten Klöster, Ikh Kuree, war eine wandernde Mönchs-Jurtenstadt bis sie mit dem endgültigen Namen Ulan Baator – was „Roter Krieger“ bedeutet – sesshaft und zur kommunistischen Hauptstadt wurde.
46
Kommunismus, Säuberungsaktionen mit Klosterschleifungen und der Ermordung von Lamas ließen eine tiefe Lücke, eine unterbrochene Tradition zurück. Heute gibt es wieder 200 Klöster mit 300 Mönchen, eines davon Amarbayasgalant.
Das Chanten der Mönche erfüllt den Raum auch als wir zurück zum Auto gehen, rechte Vertiefung und eine geistliche Stimmung wollten an diesem Ort nicht aufkommen, zu sehr fehlte hier die Ernsthaftigkeit, die tatsächliche spirituelle Nutzung dieses abgeschiedenen Ortes, zu sehr steht das Spendenbuch, ja der Showeffekt im Vordergrund! Die Rückfahrt in der Limousine verschlafe ich fast komplett trotz holpriger Schotterstraßen und Flussdurchquerung am Beginn, den frühen Abend im Hotel verdöse ich vor dem TV-Gerät, in der hereinscheinenden Sonne liegend, bei den diversen Olympiavorbereitungsberichten aus Peking.
Zum Abendessen gehe ich hinauf in den fünften Stock, ins Restaurant, mit dem Wunsch nach einem passenden Abschluss dieses besonderen Tages. Als kulinarische Herausforderung bestelle ich einen Kartoffelsalat und Blutwurst mit Reis. Beides kommt schön angerichtet und sehr unexotisch auf den Tisch, zum Ausgleich wird mit mongolischem Tiger-Beer runtergespült. Als Entrée hatte die junge Kellnerin das gefaltene Tuch aus dem Bierglas genommen und es mir schwungvoll auf den Schoß platziert. Kulinarischer Abschluss: Schokolade aus der üppigen Minibar sowie „When the postman rings twice“ mit Jack Nicholson.
47
22.07.2008
Wieder ein kreatives Hotelfrühstück – diesmal mit luftdicht verpacktem Früchtekuchen aus dem Supermarkt – danach ein bisschen emailen mit der Welt: Karl-Heinz hat die Tage in meinem Häuschen anscheinend genossen und beeindruckt unser Theaterstück besucht, Su hat noch eine stressige Woche und wird mich am 4.8.2008 vom Flughafen abholen. Um Punkt zwölf Uhr fährt der Bus nach Ulan Baator ab, zwei Stunden in der im Bus gestauten Mittagshitze später erreichen wir eine waldige Hügelgegend, auf halbem Wege eine Raststätte. Spontan beschließe ich, hier auszusteigen – zu verlockend ist die Einladung, noch einmal die mongolische Natur zu genießen, zu vorhersehbar wären der Komfort und der Ablauf der restlichen vier Tage in einem Hotelzimmer in Ulan Baator.
Auch will nochmals in diese wunderbare Landschaft eintauchen, die mich vor bald zwei Wochen von Druck und Stress befreite! Leichten Schrittes steige ich einen ersten steilen Hügel hinauf in Richtung eines Föhrenwäldchens, das sich bald, den üblichen Wermutduft überdeckend, nähert.
Steil durch die dichten Baumstände gehend erreiche ich eine Kette von Graten, die immer weiter von der Fernstraße wegführen. Eine voralpine Landschaft inklusive Edelweiß öffnet sich, ich verstecke meinen Rucksack hinter einem Baum am Waldrand und gehe mit der Wasserflasche als einzigem Gepäck weiter – Travis! Mehrere steile Hügelspitzen weiter kreuze ich durch ein weiteres Waldstück, dahinter eröffnet sich ein wunderbarer Blick über sanft abfallende Wiesen, einige Jurten und Schafherden.
48
Der Falllinie folgend gelange ich, verschiedene Kräuterduftströme querend (einer davon fast zimtig) auf eine Ebene, wo mir Kinder bedeuten zu ihrer Jurte zu kommen. Dort sitzt deren Mutter beim Schneiden und Kochen von Nudelteig, ein Baby krabbelt herum und der junge Vater im roten Netzleibchen begrüßt mich.
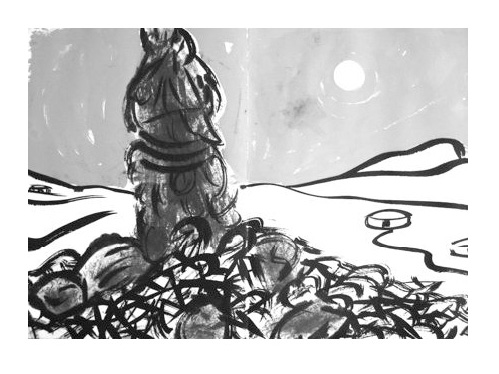
Mit dem Erwähnen von Ortsnamen versuche ich meine Wegstrecke hierher zu erklären, der Name Amarbayasgalant lässt ihre Gesichter leuchten. Ein Stück getrockneter Käse bleibt lange unzerkaubar in meinem Mund als ich mit den dazugekommenen drei Buben der Nachbarjurte eine Runde Basketball spiele: Mitten in der Graslandschaft ein dicker, eingegrabener Föhrenstamm, darauf improvisiert Brett und Ring.
Wenigstens ein brauchbares, landesweit übliches Kennzeichen der Missionierungsversuche der Mormonen aus Utah, die dazugehörigen jungen Männer mit Schlips, weißem Hemd und City-Rucksack waren mir schon in Ulan Baator aufgefallen.
49
Ich bekomme noch die Wasserflasche aufgefüllt und ziehe wieder bergauf zu Ruck- und Schlafsack. Unterwegs sitzen 50 Meter vor mir hinter einer Kuppe zwei Adler, die sich majestätisch über die Hügel erheben, als ich näherkomme, eine Steigung weiter entdecke ich zwischen Steinplatten eine große Adlerfeder. In der untergehenden Sonne schlage ich auf einer felsigen Kuppe mein Lager auf, letztes, weiches Tageslicht und ein paar aufdringliche Mücken lassen mich trotzdem einnicken.
Zwei Stunden später wache ich in der beginnenden Dunkelheit auf, schwarze Wolken und ferne Blitze ergeben plötzlich eine ganz andere Stimmung. Eine, in der man sich am Besten von diesen hochgelegenen Punkten entfernt – wegen der Blitze und des bald zu erwartenden Regens! Schlafsack und Matte unterm Arm, den Rucksack umgehängt eile ich in der jetzt ab und zu blitzerhellten Dunkelheit bergab durch den Wald, die Taschenlampe wegen der nötigen Handfreiheit im Mund. Gerade rechtzeitig mit den ersten Tropfen erreiche ich die hell erleuchtete Raststätte.
Im überdachten Außenteil setze ich mich auf eine Holzbank und beobachte den steten Fluss der Reisenden. Es scheinen eher Ortsansässige und Lastwagenfahrer zu sein, die sich ein Abendessen holen und oft auch eine Flasche Wodka. Entsprechend hängen einige stark Betrunkene im und vor dem Lokal herum, teilweise eher schräge Gestalten – einer davon versucht, Ankommenden eine Silberschüssel zu verkaufen.
Als es kühler wird, setze ich mich ins Restaurant mit den landesüblichen Fotos der Speisen, ich bestelle mir mangels kulinarischer Option Löslichkaffee und verbringe die Zeit lesend und schreibend bis drei Uhr morgens. Als der Fluss der Einkehrenden vermehrt unverdächtiger wird, lege ich mich im Schlafsack wieder hinaus in den überdachten Teil und schlafe bald ein.
50
23.07.2008
Die Fragen des pensionierten Dorfpolizisten vor einigen Tagen hatten natürlich ihre Berechtigung, lassen sich mit dem Titel einer von Bruce Chatwins Reiseberichtsammlungen vereinfacht zusammenfassen: „What am I doing here?“. Es ist in meinem Fall ja wohl nicht die übliche Kulturreise, dich ich hier mache, dann hätte ich in 20 Tagen 20 Monumente besucht, Ausgrabungen, Sakralbauten.
Welche Erfahrungen gilt es zu machen, welches Wissen zu sammeln im Zeitalter von Google und YouTube? Was ist substantieller: Ein gemütlicher Badeurlaub oder meine Version des Reisens? Ist neben der Informationsflut eines Berufsalltages noch Bedarf oder Platz für weitere Daten, sind diese mit dem Leben nach der Reise verknüpfbar? Ich denke, die Gnade in einer Welt, einem Lebensumstand zu Leben, der Mobilität erlaubt, der aus finanziellen, politischen oder intellektuellen Umständen nicht schon an der eigenen Staatsgrenze endet, ist ein Geschenk.
Dass die darum herum liegende Welt aus vielen Wahrheiten, Erfahrungen, möglichen weiteren Prägungen besteht, ist eine Tatsache, die mich auffordert, ihr nachzugehen. Wenn, während ich dies schreibe, direkt hinter mir, in einem Seitengebäude des Gandan-Klosters hier in Ulan Baator ein junger Mann ein gewünschtes Ritual erfüllt bekommt, ein Mönch beratend mit ihm spricht, so ist das Teil meines universellen Menschheitsverständnisses, Ausdruck der vom indischen heiligen Nem Karoli Baaba propagierten Einheit aller Lebewesen, aller Seelen – nur eben hier in rote Roben gewandet.
51
Man könnte auch vereinfacht sagen, dass alle Menschen spirituelle Ankerpunkte suchen, das Selbst in der weltweiten Gemeinschaft – nur eben in diversen lokalen Färbungen erleben. So eine Reise ist also eine Reise zu einem exotischen Spiegelbild, eine Reflexion des eigenen Seins, im besten Fall ein erweitertes Selbstbild schaffend.
Viele meiner Ansichten über die westliche Gesellschaft, über mich und meinen Platz darin haben sich durch Reisen ergeben. Sechs Mal Indien genauso wie drei Mal Pakistan, dann auch Mali, Madagaskar oder sechs Mal New York. Sie haben mein Berufsleben, mein soziales, sogar mein Liebesleben zumindest ebenso geformt wie meine Erziehung oder meine Existenz als Europäer.
Mein eigener Ansatz zum Beruf des Behindertenbetreuers ist ein in diesem Sinne gefundener, fast spiritueller. Entscheidend für den plötzlichen Ausstieg aus dem Leben als Grafikdesigner (innerlich war ich bereits seit Jahren ausgetreten) sind – im Nachhinein betrachtet -meine Reisen ins südliche Pakistan, das Erleben der dortigen Form des Sufismus, eigentlich die dort gelebte und erlebbare Nächstenliebe im besten christlichen Sinne.
Ein Bild der Menschheit verbunden durch Atman – nicht umsonst indogermanisch verwandt mit „Atem“. Wenn man sich dort trifft, so greift man sich ans Herz und macht gemeinsam den Pilgerweg durch eine Steinwüste zwischen zwei heiligen Orten.
52
Egal ob Bauer, Finanzexperte oder als beinloser Krüppel. Wenn man einen Irren im Staub wühlen sieht, wenn man einen hohen Wandermönch trifft – man nennt sie beide „malang“: auf der Suche befindlich – und dabei vielleicht verrückt geworden. Alle EIN Körper, EIN Geist. Oder die flehenden Eltern mit dem schwerstbehinderten Kind am Schrein des Shah Latif – in der Hoffnung auf ein Wunder durch den Heiligen. All das mag durch meine westlichen Augen einen Heiligenschein bekommen haben, vielleicht gar simple soziale oder materielle Gründe haben in dieser dritten aller möglichen Welten – in mir hat sich etwas bewegt, ich habe mich bewegt, verändert.
Was bleibt ist diese Sicht der Einzigartigkeit jedes Menschen, der Einheit aller Menschen, der Respekt vor jeder Ausformung unseres Seins. Es liegt an mir, die Wahrheiten, die es zu entdecken gilt, zu sehen; vor Ort ist oft weniger Mystik als man glaubt.
Nigel Barley, der englische Ethnologe (Eines seiner Bücher ließ mich in die Berge Thorajas auf die indonesische Insel Sulawesi fahren, um dort großartige Bestattungszeremonien zu erleben) hat ein amüsantes Beispiel für die Relativität von Wissen und Erfahrung in fremden Ländern beschrieben: In einer Gegend Ostafrikas, an der Grenze zwischen Urwald und Steppe, wollte er Dorfbewohner zu ihrem Wissen über die dort vorkommenden Leoparden und Geparde befragen. Die Antworten relativierten den wissenschaftlichen Anspruch sehr schnell, die Dorfbewohner sahen keinen auffälligen Unterschied zwischen den beiden Großkatzen!
53
Das hochkomplexe Ritual mit Litanei, Gebetsbuchschwenken und Geldübergabe hinter mir ist inzwischen beendet, der Mönch war so nett, sein zweimal zwischendurch läutendes Mobiltelefon nicht abzuheben, während den Tempel besuchende junge Mädchen die kurzen heißen Sommermonate nutzen, um sogar für europäische Verhältnisse freizügig gekleidet ihre Opferungen darzubieten.
Inzwischen nimmt eine alte Frau in festlichem Mantel Platz, um ebenfalls ein Ritual vom Mönch zu erbitten: Die Landflucht, die Verlockung der boomenden Stadt Ulan Baator lässt die mitgebrachten Alten zwischen den Welten leben. Sie sitzen vor den Plattenbauten mit ihren Reiterstiefeln, dem mongolischen Cowboyhut, den weiten Wickelmänteln, während die Jugend abends auf Rollerblades oder Funbikes in den Straßen abhängt – oder Blade-Runner-Taxis fährt! Natürlich ist hier auch der Buddhismus stärker manifestiert als auf dem Land, wo das Foto des Dalai Lama der einzige Hinweis auf Religion ist, eher der Schamane oder der Glaube an den ewigen Himmel “Munk Tenger” regiert.
Ein ähnliches Zwischen-den-Welten-Gefühl der unangenehmen Art habe ich, vom Aufenthalt in der mongolischen Flora und Fauna in die Hauptstadt zurückkehrend. Wieder im Hotel Amarbayasgalant eingecheckt, schaue ich mal kurz ins Internetcafé.
Als ich danach die Straße betrete, befällt mich ein beengendes Gefühl von Überforderung, verursacht vielleicht vom Stress der letzten Nacht, vielleicht auch vom dramatischen Unterschied zwischen der Weite und Ruhe des Landes und der Enge und dem Lärm der Hauptstadt.
Im Supermarkt kaufe ich schnell einige Exemplare einer exotischen, fast weißen Apfelsorte und schlafe schon am frühen Abend ein.
54
24.07.2008
Shopping- und Kulturtag. Wie bereits vor zwei Wochen winke ich auf der Umfahrungsstraße einen der Kleinbusse heran, die zum Markt fahren. Es ist zehn Uhr, und die Verkäufer beginnen teilweise erst aufzubauen. Entspannt und neugierig schleiche ich durch die mittels Gittern, auf denen die Produkte aufgehängt sind, abgegrenzten Verkaufsgassen.
Die meisten bieten modische Kleidung und Schuhe an, genauso aber auch Dichtungen, Polstermöbel oder Kochtöpfe. Hier einen mongolischen Wickelmantel probiert, dort einen etwas steifen Cowboyhut, kaufe ich einen blau-grünen Sommer-Tarnanzug des mongolischen Militärs, und finde den kleinen Antiquitätenmarkt wieder, auf dem mich schon bei meinem ersten Besuch die viergesichtigen Köpfe fasziniert hatten. Aus einer Kugel ist ein Kopf mit vier verschiedenen, asiatisch geschnittenen, Gesichtern geformt, auf jeder Seite eines: Lachend, traurig, freudig und neutral blickend. Es gibt sie in Größen von fünf bis zwölf Zentimetern, aus Messing oder Silber.
Nach kurzem Feilschen erstehe ich jeweils einen in mittlerer Größe und den einzigen aus Holz. Zu Mittag suche ich mir Stand Nr. 16 aus, eine der vielen Garküchen, welche die frischen Produkte des Marktes verarbeiten. Die Fotos an der Wand, die allgemein zum Bestellen dienen, wirken hier am appetitlichsten, wenn auch unklar ist, was sie darstellen. Fast ein wenig wie Anthony Bourdain komme ich mir vor, der Bücher schreibt und TV-Dokus dreht über kulinarische Momente wie diesen.
Am nächsten kam ich seinen Grenzerfahrungen beim Essen von frittierten Grashüpfern und Maden in Bangkok. Hier hat der Zufall die landesüblichen Teigtaschen mit faschiertem, kaum gewürztem Hammelfleisch sowie einen bunt mit anderen Gemüsesorten durchmischten Kartoffelsalat auf meinen Teller gelegt. Beides köstlich, einfach und sehr mongolisch – Nudeln und Wurst hätten zur Komplettierung des üblichen kulinarischen Spektrums noch gefehlt. Satt und mit praller Einkaufstasche fahre ich ins Zentrum zurück, bringe selbstgemalte Postkarten zur Hauptpost, die wie eine schlampige, kleine Landfiliale wirkt – vor allem, weil es am Land gar keinen Postservice gibt, auch wurde er in der Hauptstadt bis vor kurzem vor allem mittels der hier zuhauf die Wände füllenden Postfächer geregelt.
55
Zwei Straßen weiter – die Nationaloper zeigt kein Zeichen von Leben, keine Spieltermine sind außen sichtbar – ist in einem roten klassizistisch anmutenden Gebäude das Museum der Werke von Zanabasar untergebracht. Wenn man als erste gesprochene Worte bereits tibetische Mantras rezitiert, der Großvater Gründer eines Klosters war, die Reise nach Tibet einen als Wiedergeburt eines hohen Lamas bestätigt, dann hat das Schicksal anscheinend einiges mit einem vor: Neben den bereits erwähnten klerikalen und religionspolitischen Tätigkeiten auch die hier dokumentierte handwerkliche Fähigkeit Messingfiguren zu fertigen. Klassische tibetisch-buddhistische Motive, wie die 22 Taras, Garuda oder Stupas wurden auf einen Standard von Materialbearbeitung, Detailliertheit und künstlerischer Gestaltung gebracht, der ihn zum anerkannt bedeutendsten Bildhauer dieser Stilrichtung und seiner Zeit werden ließen.
Tsam-Masken mit ihrer bunten Totenkopf- Schrecklichheit vielschichtige Stoffapplikationsbilder in großen Formaten und Thangkas, teilweise wiederum der beschützenden Taras sowie historische Malereien von Tsam-Feierlichkeiten und zarte Tierzeichnungen bestücken den Rest der Ausstellung. In den ersten Raum zurückgekehrt, ringe ich der Wächterin einen Sessel ab, um mich einige Zeit in die angeblich wundertätige weiße Tara zu vertiefen, an Su zu denken – und mich über den Amerikaner zu amüsieren, der sich wiederum über die spitzen Brüste einer Garuda-Figur amüsiert. Kunst macht hungrig, also setze ich mich in ein Straßenlokal, um – wie anscheinend alle rundherum – ein 5er-Set Hammelteigtaschen zu essen.
Auch hier kaum gewürzt aber trotzdem intensiv im Geschmack. Abends fiel mir ein, bei der Ankunft aus Darchan ein großes Kino passiert zu haben, ich spaziere dorthin und schaue mir auf der riesigen, modernen Leinwand Indiana Jones Teil IV. an, auf Englisch, mit mongolischen Untertiteln.
56
25.07.2008
Mongolischer Buddhismus tibetischen Ursprungs, gelebt inmitten von Ulan Baator gibt es vielfach, im größten Kloster der Stadt ist auch gleich die größte Statue des Landes, 27 Meter hoch, zu bewundern. Das Gadan-Kloster besteht seit mehr als 150 Jahren als Ort der buddhistischen Wissenschaft, heute vornehmlich als Heimat dieser Nachbildung einer monumentalen Statue, die hier 1911 entstand, den Boddhisatva des Mitgefühls darstellend.
Den Kommunisten mangelte es anscheinend genau daran, als sie die Statue 1938 nach Leningrad transportierten, um sie entweder in Teile zerlegt im Keller der Eremitage zu deponieren – oder sie einfach zur Waffenproduktion einzuschmelzen, je nach Textquelle. Das geschlossene Kloster wurde auf eine Petition von Mönchen hin 1944 wieder eröffnet, erreicht aber inklusive der angeschlossenen Mönchsschulen nur den Stand von 900 statt der 5000 Mönche von vor der kommunistischen Säuberungsaktion. Während dieser wurden Mönche getötet, nach Hause geschickt oder zur Heirat gezwungen.
57
1996 erstand dieses Symbol der Größe des mongolischen Buddhismus auf private Initiative hin wieder in voller Pracht: aus Kupfer, vergoldet, edelsteingeschmückt. Der Dalai Lama hält beschützend seine Hand über diese Gebäude, er wähllte Ulan Baator 1995 als Ort des Kalachakra-Rituales und entsandte Lamas, um die Kunst des Fertigens von Mandalas aus Farbpigmenten wieder zu installieren. Viel weltlicher ist mein Wunsch nach Sandalen, nach zwei Wochen in den selben Treckingschuhen, die Hitze Pekings und das Ende meiner Wanderungen bedenkend.
Eine zentral gelegene Halle mit messestandartigen Kojen bietet originelle Kopien und Interpretationen von Weltmarken wie Puma und Gucci an, Kleidung – und Camouflage-Slipper mit Reflexzonen-Fußbett! Auch ist heute mein letzter Abend in Ulan Baator und ich habe mir den Besuch eines im Reiseführer empfohlenen koreanischen Spitzenrestaurants als letztes Highlight aufgehoben. Die unlesbare, aber mit Fotos illustrierte Speisekarte empfiehlt als Option zu den undefinierbaren mongolischen Nudeln-mit-Fleischstückchen-Suppen kulinarisch nicht wirklich Erleuchtendes: Nudeln-mit-Fleischstückchen- Suppen zu sehr gehobenen Preisen.
Plan B: noch mal Kino, der auf China vorbereitende amüsante „Kung Fu Panda“ und gleich daneben ein weiterer Koreaner mit klar nichtmongolischen Teigtäschchen und Meeresfrüchte-Mix – die lautstark singende Clique im Karaokeraum als Draufgabe. Genüssliches Flanieren durch eine laue Freitagnacht, vorbei an der belebten Hauptstraße, dem riesigen State-Department-Store, der ausgebrannten State-Galery, dem kommunistisch protzigen „Hotel Ulan Baator“, zurück zum Hotel mit dem schönen Namen eines schönen Klosters.
58
26.07.2008
Immer wenn der achte Bogd eine Reise tat, fragte er vorher seinen Bruder, ob sie auch gut ausgehen würde. Natürlich war auch sein Bruder nicht irgendjemand sondern als Choijin-Lama das Staatsorakel. Sein Job war es, hauptberuflich in Trance zu fallen und aus Nebenwelten Wahrheiten mitzubringen.
Eine sehr anstrengende Aufgabe, während deren Ausführung er auch verstarb – aus einer Sitzung hinterließ er ein Schwert, das er wie ein Stoffband verbogen und gefaltet hatte. Es ging auch leichter, in dem er aus dem Aussehen eines angekohlten Hammelschulterblattes die Zukunft las. Trotz seiner persönlichen Verbindung mit dem letzten Bogd, der auch ähnlich dem Dalai Lama in Tibet der politische Führer des damaligen Gottesstaates Mongolei war, wurde sein Kloster vom neuen kommunistischen Führer aus der Liste der zu schleifenden Gebäude gestrichen. So blieb dieses Tempeljuwel erhalten, umgeben von mutig geschwungenen Hochhäusern und Geschäftsvierteln.

59
Was mir hier wieder auffällt, ist die Transformation des ursprünglich puristischen Buddhismus zu dieser hochmanierierten, barocken Ausformung in Tibet, der Mongolei. War der Buddhismus eine Revolution gegen die überbordende Macht der hinduistischen Brahmanenkaste, deren verschnörkelte, zu bezahlende Rituale, so ließ sich die Revolution während ihrer Missionstätigkeit abändern.
Um Tibetern den Buddhismus nahezubringen, wurde einfach deren animistisch-dämonisches Glaubensbild integriert. Was man in mongolischer Folge dann mit schamanistischen Teilen und der Farbe Blau statt Gelb tat, ist dann aber auch uns geläufig mit dem keltischen Osterhasen und der Verlegung von Weihnachten auf die zu ausufernden Saufund Orgientage zum Jahresende im römischen Imperium.
Das Kloster als solches wird nicht von Mönchen genutzt, es ist ein Museum mit farbprächtigen Tempeln und Objekten in Glaskästen – darunter auch einige Figuren, gefertigt von Zanabasar. Dämonen links und rechts auf mystischen Reittieren, korallenbestickte Tsam-Masken, Malereien von bestialischen Höllenqualen begleiten mich auf eine Gedankenreise zurück in die Steppe, auf Hügelkuppen, unter Myriaden von Sternen, in eine Mongolei so wie ich sie erleben durfte, wie sie sich mir darstellte – als eine von vielen Wahrheiten auf einem Planeten mit genauso vielen Lügen.
Der Flug von Dschingis Khan International Airport hebt pünktlich um 17 Uhr ab, noch einmal breitet sich das ewige Grün aus, noch einmal ziehen sich Millionen von Hügeln bis zum Horizont. Als wir zwei Stunden später in Peking landen, ist das mehr als nur ein anderes Land, hier ist auch eine andere Zeit, eine nicht in Stunden bemessbare, eher in Lichtjahren! Lord Norman Foster hat mit seinem beim Hinflug frühmorgends bereits durchschrittenen Riesenflügel den weltgrößten Terminal (größer als alle Terminals von Heathrow zusammen) innerhalb von fünf Jahren von zeitweise bis zu 50.000 Arbeitern bauen lassen.
60
Ein Gebäude mit der optischen Leichtigkeit, die den stoffbespannten ersten Fluggeräten von Otto Lilienthal entspricht. Alleen für Fußgänger, Marmor, Glas, Kunststoff, alles im logisch strengen Konsens einer optimalen, glatten Abwicklung der Flugreisenden. Noch nie habe ich mich auf einem Flughafen, in einer neuen Stadt ankommend intuitiv so wohl gefühlt, mich derart entspannt und vertraut gefühlt – ob das Feng Shui oder das perfekte graphisch-textliche Leitsystem ist oder einfach nur das Aufatmen nach der permanent spürbar leicht chaotischen Mongolei, ich weiß es nicht.
Sicher wie ein Raumschiff in Menschengestalt gleite ich wie auf Autopilot programmiert durch Passkontrolle, Gepäckabholung und weiter zur erst seit zehn Tagen eröffneten U-Bahn-Linie welche Flughafen und Stadtzentrum verbindet – umgeben von den lächelnden Gesichtern der anderen Reisenden und bereitstehender Hostessen beiderlei Geschlechts, die hier zwei Wochen vor der Eröffnung der Olympiade schon an perfekt designten Schaltern bereitstehen.
Im Duty-Free noch schnell als Willkommensgeschenk für mich ein 5er-Pack Romeo y Julieta-Zigarren gekauft, nebenan schwache restliche Dollar und gute Euros auf Yuan gewechselt und ab geht’s in die unendlichen Weiten der Flughafenhallen. Die U-Bahn-Linie ins Zentrum – ein Wunderwerk an gleitenden Türen und großformatigen Fenstern – fliegt quais durch abendliche Vororte und beginnende Hochhauslandschaften. Irgendwo müssen die 16 Millionen Einwohner inklusive einiger Millionen Wanderarbeiter ja wohnen, erstere tun es an breiten, gut beleuchteten Autostraßen, unterbrochen von bunt beschrifteten Tankstellen und neben Bürohochhäusern und Shopping Malls. Die Flughafenverbindung mündet in die Linie „2“, die den zweiten Innenstadtring umrundet, um 20 Uhr an diesen Samstagabend natürlich sehr voll.
61
Da bekommt man mit Bergsteigerrucksack, Schlafsack und am Flughafen in Ulan Baator wieder aufgetauchtem Zelt lächelnd sogar einen Sitzplatz angeboten. An der Station Hepingmen aussteigend bricht die nicht künstlich gekühlte sommerliche Luft Beijings über mich herein: schwül, drückend, nach den ersten Straßenrestaurants riechend – und nach tropischer Fäulnis. Nach den zehn Minuten Fußmarsch zum Far-East-Hotel bin ich schweißgebadet und werde in der Lobby gleich wieder auf 15 Grad heruntergekühlt. Die Farce der sich in Richtung Olympiade überschlagenden Hotelpreise ist real: 29 Euro bis 31. Juli, 49 Euro ab dem 1. August für dasselbe Zimmer – für den hier gebotenen Komfort aber immer noch weniger als der halbe Preis eines europäischen Hotels gleicher Klasse.
Mein schmuddeliges Travellergepäck wirkt unpassend in diesem bügelfrischem Zimmer, ich gehe lieber mit einer Zigarre in der Hand die Hauptstraße dieses Hutongs entlang, einem der wenigen restlichen alten Wohnbezirke in Zentrumsnähe. War das Hutong, dieses Winkelwerk an Gassen und Höfen früher die Norm, so ist es im Rahmen der allumfassenden Erneuerung Beijings inzwischen eher die Ausnahme. Bei aller Romantik aber auch ein oftmals nötiger Schritt, weg von improvisierten Trennmauern, öffentlichen Toiletten und primitiven Waschgelegenheiten. Dieses kleine Viertel ist durch einige Hotels und Herbergen für westliche Klientel mit einer breiteren Palette an Geschäften und Lokalen besser bestückt als sonst üblich – vom Restaurant, in dem ein Drittel der Tsing Tao-Bier trinkenden Gäste Nichtchinesen sind (Speisekarten in chinesisch/englisch mit geschmackvollen Fotos der Speisen) bis zum Schneider, der auch Mao-Jacken in meiner europäischen Größe fertigt.
62
An der Ecke, gegenüber von einem Lokal das in riesigen Neonlettern vermutlich auf seine Spezialität, das Selbstgaren von Fleischstückchen in Gemüsesuppe, hinweist, sitzt eine Gruppe von Europäern auf den Stufen vor einem Gemischtwarenladen bei einer Flasche Bier. Peter und seine Kollegen aus Frankfurt richten hier für Nike ein Erholungszelt der deutschen Athleten neben dem Vogelnest, dem Fünfkampf-Stadion, technisch ein – mit Videowalls und einem Kamerasystem zur Überwachung. Gutes Geld für ein paar Tage Aufbau, Heimflug, nochmaliges Einfliegen und Abbau am Ende der Spiele. Geschichten über den enormen technischen Aufwand, die Arten von Zubereitung der Pekingente und das neue Benimm-Regelwerk für die Beijinger Bevölkerung werden erzählt, der zu letzterem anscheinend gehörige Verlust der optionalen manuellen Befriedigung von Klienten nach der klassischen chinesischen Massage bedauert.
Einer der 60 rein chinesischen TV-Sender im Hotelzimmer zeigt dann tatsächlich einen Werbespot, der den Stolz der Pekinger auf die Olympiade darstellen soll: Darin werden auch Benimmregeln nahegelegt, zum Beispiel einem laut in der U-Bahn ins Mobiltelefon redenden Mann das Leisersprechen nahgelegt, Touristen wird anstatt weg zu sehen der Stadtplan erklärt. Immer noch mit einem breiten Lächeln über die ersten, vielfältigen Eindrücke auf den Lippen dürfte ich wohl eingeschlafen sein.
63
27.07.2008
Au! Beim Aufwachen ein stechender Nervenschmerz im linken hinteren Beckenteil, ohne Vorwarnung! Schmerzen im Bett, beim Duschen, beim Fahrrad ausleihen, unterwegs etwas weniger. Das Viertel in Richtung Tienamen-Platz verlassend ist dessen Lebendigkeit und Vielseitigkeit eine bunte Freude, die Geschäfte mit Mao-Postern, Flugdrachen im 10er-Pack, Restaurants die um elf Uhr bereits voll sind mit sonntäglichen Familientreffen.
Überhaupt scheinen alle unterwegs zu sein, besonders an den innerstädtischen Seen, die eigentlich große Teiche sind. Hier flanieren Pärchen, sitzen Pensionisten in Rollstühlen, ein stolzer Segway-Fahrer, Badende, Cocktailbars mit dem Flair von Miami entlang des Spazierweges. Hier ist bereits begreifbar, dass die Größe des Stadtzentrums, die auf dem Plan maximal mit der U-Bahn bewältigbar scheint mit dem Fahrrad eine erfassbare Dimension bekommt, anscheinend gemütlich in maximal drei Stunden durchquerbar ist.
Größe anderer Art tut sich auf, als ich einer Allee folgend an einem Eck des “Platzes des himmlischen Friedens“ stehe, den diese Straße in der Breite einer achtspurigen Autobahn überquert – unter den immer noch wachsamen Augen Maos.
64
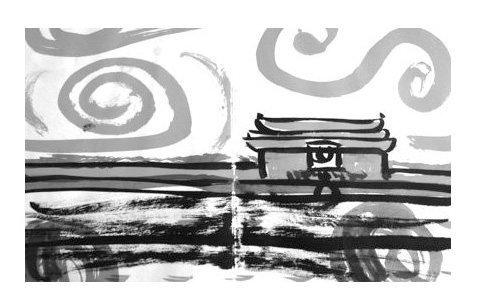
Großartig! Faszinierend! Auf dem Fahrrad gleite ich auf einer eigenen Spur, die ein Drittel der Fahrbahnbreite ausmacht, vorbei an der Achse „Tor des himmlischen Friedens“ und Mao-Mausoleum. Wie in einer Traumsequenz erlebe ich dieses Gleiten durch die tropische Schwüle, durch diese fast mongolisch weite Stadtlandschaft. Eine kaum erklärbare Euphorie, die ich in den nächsten Tagen möglichst oft, auch Umwege machend, suchen werde! Dieselbe Gerade fortsetzend passiere ich das renommierte Raffles und einige weitere Luxushotels, lasse mich treiben durch Alleen, vorbei an frisch poliert wirkenden Bank-, Versicherungs-, Weltkonzernhochhäusern in elegantem, mutigen Design aus Marmor, Glas und Stahl.
65
Immer augenfällig das viele Grün, die Breite der Fahrradspuren, die Großzügigkeit des ganzen Stadtplanes. Bei aller Modernität hat man auch versucht, den Abriss vieler Hutongs durch das gleichzeitige aufwändige Renovieren bestehender, wertvoller historischer Wohnbauten auszugleichen. Oder eine seltsame Stilblüte an der Quianmen- Straße zu pflanzen: Hier wurde eine bestehende aber heruntergekommene alte Hauptstraße anhand von alten Fotos rekonstruiert, mit den technischen Möglichkeiten und dem touristischen Denken von heute.
Künstlich wie eine Film-Westernstadt, mit den angesagtesten europäischen, amerikanischen und asiatischen Marken als Mieter im Erdgeschoss, Restaurants meist im ersten Stock, stoffverhangene Vogelkäfige an historisierenden Laternenmasten, die vermutlich später mit digitalen Nachtigallen bestückt werden.
66
Die Stadt, wie sie Mao quasi von den Ming-Kaisern übernahm, war umgeben von einer Stadtmauer, diversen Stadttoren, die heute den ersten Ring definieren. Das imense Wachstum der Stadt führte ab den 1980er- Jahren zu immer weiteren nötigen Ringstraßen, heute gibt es bereits sechs davon. Mich aus dem Zentrum nach Außen bewegend, vermehrt an Wohnhochhäusern vorbeikommend, stehe ich plötzlich vor dem international medial stark präsenten „The Place“, der eigentlich „The Space“ heißen müsste.
„Hier ist ein Raumschiff gelandet, das funkelnde, wechselnde Oberflächen hat“, würde ein alter Bauer aus dem chinesischen Hinterland hier vorbeikommend vermutlich sagen, die Shopping-Malls links und rechts davon würde er schon eher erklären können, auch wenn sie voll sind mit Boutiquen europäischer Designer, mit Starbucks und einem im Olympia-Rausch befindlichen Nike-Store. Der bis vor kurzem größte LED-Bildschirm der Welt draußen vor der Tür zeigt auf 250 mal 30 Metern korallenbunte Unterwasseraufnahmen, wogende Sonnenblumenfelder oder – je nach Anmieter – auch Coca Cola Werbespots. Der Konzern bebaut gerade die Fläche unter dem 20 Meter hohen Bildschirmdach mit einer Erlebniswelt für Konzerte und Fernsehshows zur Olympiade. Eine knallrote, glitzernde Kultstädte für Zucker und Koffein.
Eine Show ohne Strom und doppelten Boden erlebe ich dafür am Abend: ein großes, altes Theater, das von einer staatlichen Artistenschule für Vorführungen genutzt wird. Nicht mehr als 50 Chinesen und Touristen dürfen eine Meisterschaft erleben, die hier zum Standard gehört, die in Europa dank (schon wieder!) André Heller zum Glück auch erlebbar war.
67
Wenn neun Mädchen, ungefähr 12 bis 15 Jahre alt, am Rücken liegend große Trommeln mit den Füßen rotieren lassen, sich abwechselnd diese – oder ihre Partnerinnen – in raschem Rhythmus zu passender chinesischer Musik mit den Füßen kraftvoll weiterreichen, wenn sie sich wie eine Truppe militanter Elfen Diabolos quer über die Bühne Saltos schlagend mit Schnüren zuspielen – dann ist dies Unterhaltung auf höchstem künstlerischen Niveau.
Dargebracht mit jener Leichtigkeit, die jahrelanges, hartes Training voraussetzt. Die darauffolgende Truppe von Burschen zwischen sechs und 15 ließe auf zwei vertikalen Stangen eine Armada Affen ungelenk aussehen!
Der Hunger nach chinesischer Küche in der Originalversion lässt mich kurz vor dem Hotel ein neonleuchtendes Lokal betreten, das dank appetitlicher Fotos zum Kosten wundersamer Speisen einlädt.

68
Hongkong-Chinesen sagt man nach, dass sie alles außer Flugzeugen essen, hier isst man etwas weniger exzentrisch. Eher kulinarisch pfiffig, auch in den Bildtexten: „pig-ellbow“ oder „Schafsleber im Melonenboot“ sagen klar, was man bekommt, die „differently spiced chickenbreast“ ist dann eine wunderbar vor allem durch Marinade finalisierte, von Koriander grün bedeckte Hühnerbrust. Der Aal mit Bambussprossen ist in Fingerlänge angebraten, eher optisch als kulinarisch interessant. Frösche und Tauben gäbe es auch, Schildkrötenteile, aber ich bin nach den beiden Gängen schon wunderbar satt, ein leichtes aber würziges lokales Bier rundet die interessante Menüfolge ab.
Bier ist überhaupt auf Reisen ein anderes Getränk als zu Hause, wo ich nach einem Krügerl schon müde und schlapp bin. In Mali gab es als Abendritual in staubigen Straßenlokalen während der Woche in Segou, auf ein Schiff wartend das uns dann den Niger hinauf nach Mopti brachte, immer Stella Artois, Baguette und Salz aus dem Streuer. Hier ist mein Favorit das Tsing Tao, also hole ich aus dem Hotel eine der Zigarren und genieße sie mit einem Bier auf den Stiegen vor dem Geschäft, die abendlichen Nachbarschaftscliquen rundum beobachtend, wie sie das chinesisches Schach Xiangqi auf Klappsesseln sitzend spielen oder auf Fauteuils im Freien Neuigkeiten austauschen.
Diese kleinstädtische Idylle in der Megapolis Beijing ist mittlerweile sicher rar geworden, Millionen von Menschen leben in den weitläufigen Satellitenstädten außerhalb des vierten Ringes.
69
Im Hotel-TV sind alle 60 Sender rein chinesisch, voll mit Kung-Fu-Mönchen, Songcontests, Soaps und einem Nachrichtenkanal auf Englisch, der spätabends dann über den Erfolg der neuen Kennzeichenregel berichtet. Was wie flüssiger, aber doch starker Verkehr auf mich wirkte, ist bloß die Hälfte dessen, was sonst auf den Straßen an Autos fährt, heute waren die geraden Kennzeichen-Endzahlen dran – Taxis, Busse, Polizei und Politik ausgenommen.
Das lässt mich natürlich einige meiner bisherigen Eindrücke relativieren. Was erscheint – nur während der Spiele – so perfekt und angenehm, was sehe ich durch so manches glättende Regelwerk nicht. Welche baukosmetischen Korrekturen werden durch die allgegenwärtigen olympiabunten Baustellenzäunen erreicht, welche baufälligen Gebäude dahinter versteckt?! Noch war ich in keiner Weltstadt, die so frei war von Bettlern und Verrückten, hier ist deren Zahl gleich Null – künstlich durch den Abtransport von Auffälligen erreicht? Wie sehr ist das Bild des bösen, alten Chinas ausgelöscht, hat eine tatsächlich revolutionäre Führungsschicht übernommen, verbirgt die polierte Fassade gar eine viel grausamere Fratze? Fragen, die man sicher nicht im Beijing dieser Tage beantwortet bekommt, ich müsste aufs Land fahren, in die Provinzen, in die Fabriken die zur Verbesserung der Luftqualität aus Beijing ausgebürgert wurden.
Momentan habe ich Spaß daran, diese mir präsentierte „brave new world“ zu erkunden, kurz vor Mitternacht fliege ich wieder auf dem Fahrrad über den „Platz des himmlischen Friedens“, über fußballplatzgroße Strassenkreuzungen, an olympisch gestalteten Blumenrabatten vorbei.
70
28.07.2008
Der Morgen bringt ein wenig Übelkeit, Bauchgrummeln und Durchfall, die chinesische Küche hat anscheinend noch andere Besonderheiten. Trotzdem mache ich mich später für einen touristischen Fixpunkt, die Pekingente bereit. Ein von Nachbarn und einigen Touristen besuchtes weiß gefliestes Lokal lädt mich ein, besser gesagt, die lustig winkende, rundliche kleine Kellnerin mit ihrer Foto-Menü- Karte. Dieses Geflügel fand sich auf dem Speiseplan der Kaiser – und zwar exklusiv nur dort – an manchen Tagen gemeinsam mit bis zu 150 anderen Gerichten. Die Zubereitung variiert inzwischen, die nackte Ente wird über einen Hauteinschnitt am Flügel mit Gemüsesuppe gefüllt, danach gegrillt. Andere schmoren die ganze Ente, um sie danach erst auszunehmen, mit Brühe zu füllen und über Obstbaumholz zu grillen. Jedenfalls wird dann das Brustfleisch in schmale Streifen geschnitten, um gemeinsam mit Lauch- und Gurkenstreifen und dicker Hoisinsauce in dünne Teigfladen eingewickelt zu werden. Eine umwerfende Kombination aus knusprigem Fleisch, knackigem Gemüse, weichem Teig und der Salzigkeit der Sauce. Dazu natürlich ein Tsing Tao!
Den Nachmittag verbringe ich auf dem Fahrrad, pendelnd zwischen mondänen Shoppingcenters, verwinkelten Hutongs und einem der neuen architektonischen Paradestücke Beijings: Dem 234 Meter hohem CCTV-Tower. Eigentlich baut sich hier das Staatsfernsehen keinen Turm, sondern lässt zwei am Kopf stehende „L“ im Winkel von 90 Grad treffen.
71

Die statischen Bedenken wurden beseitigt, indem hunderte Betonmischer wochenlang eine Plattform gossen, aus der das schwarze Gebäude entwächst. Auf demselben Sender wird dann von der Pressekonferenz über die Olympiabauten berichtet: China erwähnt die entwerfenden Architekten mit keinem Wort, dafür aber wird die technische Leistung der örtlichen Baufirmen herausgestrichen, die Nutzung von Altwasser zum Betonmischen und das bis zu 30 Prozent recycelte Baumaterial für das Fundament.
Ob sich die Herren Herzog & de Meuron in der Schweiz und PTV Architects in Sydney über den vorenthaltenen Ruhm für „Vogelnest“ und „Wasserwürfel“-Schwimmhalle“ freuen? Genug Vorwürfe an die Architekten sie wären Handlanger und Monumentalerbauer eines totalitären Regimes, gab es ja schon, da hilft die Anerkennung für die Tennisstadion- „Lotusblüte“ und den „Tautropfen“ Nationaltheater kaum hinweg. Ich absolviere die nächste Portion Designeskapismus und besuche abends die gehobene Partymeile der Stadt.
72
Ein Teil der das alte Arbeiterstadion flankierenden Straße ist Tür an Tür mit den coolsten Clubs bestückt. Wunderwelten aus neuesten Lichteffekten, Nischen mit weißen Lederfauteuils unter Raumschiffplafonds tun sich auf, Party-déja-vus aus New York und Barcelona multiplizieren sich, Barbarella ist Chinesin und 30 Jahre alter Whisky der Raketenbrennstoff. Hip-Hop und R&B aktuellster amerikanischer Prägung tönen aus perfekten Soundsystemen, discoleichter House auf den Tanzflächen, Karaoke in einzeln mietbaren Räumen voller High-Tech und Architectural-Digest-tauglichem Interieur. Einzig die Namen „Babyface“ oder „Angel“ passen nicht zur Perfektion dieser Partywelt, auch nicht der flughafenmäßige Bodycheck.
Die aufdringlichen Kellner mit der teuren Whiskykarte animieren mich eher zum Besuch des jeweils nächsten Clubs, im ebenfalls unpassend betitelten aber neonseligen „Coco Banana“ tanze ich ein wenig – bis ich von Neugier getrieben auf dem Fahrrad weiter durch die laue Nacht ziehe. Fahrradfahren in tagsüber oft tropischer Schwüle? Eine eigentlich unlogische Anstrengung, ist doch das Taxifahren in Beijing unglaublich billig: Der Taxameter beginnt bei zehn Yuan (ca. ein Euro) und zählt erst weiter, wenn diese Fahrtmenge erreicht ist. Das dauert ewig, und entsprechend wenig kostet die restliche Strecke, maximal ein Drittel einer europäischen Taxifahrt.
Trotzdem bevorzuge ich den Nachtwind, die Breite der Radwege, die fühlbar angenehme nächtliche Atmosphäre dieser Stadt. Das Endziel dieses nächtlichen Ausfluges ist „The World of Suzie Wong“, der gleichnamige Club, den mir drei junge Damen empfahlen als ich nachmittags die ebenfalls unschlagbar tiefen Preise für CDs in einer Shoppingmall für einen Einkauf nutzte und sie mich mittels „Do you speak English?“ zum Sprachtraining aufforderten.
73
29.07.2008
An diesem klaren Morgen aus dem Hotelzimmer blickend erkenne ich das Doppel-L des gestern mit dem Fahrrad besuchten CCTV-Towers in einer Nähe die klar macht, wie groß dieses Bauwerk sein muss, nämlich riesig, war es gestern doch eine Stunde auf dem Fahrrad dorthin!
Dieses Relativieren der Proportionen finde ich immer erstaunlich, die Bereitschaft, sie aus Interesse zu überbrücken. Ein fast lebensphilosophischer Gedanke: Anziehendes erreicht man leicht und schnell, anderes ist trotz geringeren Aufwandes kaum erreichbar. So auch – wieder auf Bauwerke angelegt – im Fall meiner Expedition zu den beiden berühmtesten der neuen Olympiabauten: das mittels tonnenschwerer Stahlbänder definierte Vogelnest, in dem die Eröffnung stattfindet, ist im Inneren ein klassisches Leichtathletikstadion. Erreichbar auf einer geraden Linie von meinem Hotel aus Richtung Norden, sämtliche sechs Ringe kreuzend. Gleich daneben befindet sich das „Wasserblasen“-Schwimmstadion.
Der Weg dorthin führt aus dem Hutong meines Hotels auf dem Schachbrettraster der Strassen entlang der „Verbotenen Stadt“ an repräsentativen Geschäftsvierteln vorbei in die ersten mit Einkaufsstraßen durchsetzten Wohnviertel. Unterwegs lassen mich Hunger, Durst und Neugier bei einem Straßenlokal halt machen, eigentlich ein garagengroßes Loch in der Wand einer Geschäftsreihe in einer baumbestandenen Allee.
74
Einladend war die Präsentation der Gerichte, ihre Zubereitung und die gemütlich auf Holzbänken sitzend, Pause machenden Nachbarn. Hier werden Holzspiesschen in Suppe gegart, in einem Blechtrog auf Stelzen, der zuerst eher wie eine Grillgerätschaft aussieht. Anscheinend sucht man sich die Art des Aufzuspießenden aus oder bedient sich aus dem Trog von Fertigem. Ich entschied mich schnell für die zweite Variante und kam auf zehn optisch verschiedene Spießchen. Mehr als Farben oder Formen konnte ich zur Differenzierung nicht benutzen. Einer der zehn sah wie Leber aus, der Rest wechselte von weissen genoppten und wellenförmigen Streifen über wurstförmige Nichtwürste in Grün bis zu beigen exakten oder abgerundeten Würfeln.
Ich nehme an, dass es sich bei den meisten Spießchen um Varianten von Tofu handelt oder bei einem um etwas, das ich für Seetang halte. Konsistenz und Geschmack sind verschiedenst aber einander genussvoll und scharf abwechselnd. Klar ist man aufgrund von europäischen Vorurteilen gegenüber den „kreativen“ Möglichkeiten der hiesigen Küche schnell bereit zu vermuten, das Gebotene wären obskure Teile von ebenso obskuren Tieren – was soll’s, so lange mit einem Tsing Tao ebenso geschmackvoll runtergespült werden kann…
Eine Reihe von Querstraßen weiter wird zwischen hohen Wohnhäusern eine breite Autostraße, ein Autobahnkreuz sichtbar, das gerade auf die Stadien zuführt. Interessanterweise hat diese Wohngegend eine Qualität, wie man sie eher von Planzeichnungen aus dem Rest der Welt kennt, die dort aber selten genauso realisiert werden.
75
Was auf Plänen grünt, grünt hier tatsächlich, was an Abständen der Bauten zueinander, an Leichtigkeit der Ausführung gezeichnet wird, existiert hier tatsächlich. Auch hier wieder das Gefühl, nicht in China zu sein, eher in der futuristischen Version einer tatsächlichen Weltstadt.
Noch beeindruckender als die Stadien ist für mich ein links davon stehendes, turmförmiges, sehr hohes Gebäude mit einem wellenförmigen riesigen Tropfen, einer Fönwelle, einer brennenden Fackel(!) als Krönung. Am Rande dieses verschlungenen Straßentreffpunktes ist eine Reihe von vor allem chinesischen Touristen aufgestellt, das „Vogelnest“ fotografierend. Viel näher als auf diese 500 Meter kommt man nicht heran, ein weitläufiger Zaun ist rundherum aufgestellt, Sicherheitspersonal bewacht einzelne Eingänge – vermutlich schon in Art und Weise der kommenden Wochen. Alles hier scheint wie Dornröschen auf den erweckenden Startkuss zu warten, in Zelthallen werden Freiwillige instruiert, Menschen in Anzügen haben Eintrittspässe am Hals baumeln und Pressefotografen dokumentieren diese finale Phase. Freiwillige, freiwillig ihren Stolz als Chinese, als Bewohner von Beijing nach aussen tragende Menschen sind überall in der Stadt postiert: in Alleen, auf Gehsteigen, unter Hochstraßen, alte Damen im Olympiaoutfit sich mittels logobedruckter Fächer Kühlung verschaffend genauso wie mitten in der Nacht vor den wichtigen Hotels in Form von Studenten, von scherzenden Männergruppen die auch mal Xiangqi spielen. Könnte man in einer amerikanischen Metropole geschätzte 100.000 Ehrenamtliche rekrutieren?
76
Würden hunderte Exilchinesen auf eigene Kosten ihren Urlaub in ihrer Heimat verbringen, um mittels ihrer erworbenen Fremdsprachkenntnisse dem entsprechenden Gastland organisatorisch zu helfen? Wohl kaum, vor allem nicht lächelnd und mitten in der Nacht. Dass in diesen Tagen noch niemand Auskünfte über U-Bahnlinien oder Ahnlichem erfragt, tut der merkbaren Begeisterung für dieses Projekt keinen Abbruch. Sogar in Geschäften und Lokalen sehe ich gekennzeichnete Mitarbeiter, die aufgrund ihrer Englischkenntnisse als Informationsquelle fungieren wollen. Das „Vogelnest“ und der „Wasserwürfel“ daneben können mich nicht so begeistern wie die in den letzten Tagen gesammelten Eindrücke über diese großartige Stadt und ihre Bewohner. Die Einstimmung auf die für viele Chinesen exotischen Spiele reicht so weit, dass im Fernsehen die einzelnen Sportarten erklärt werden, man Tennisbälle, Volleybälle und Basketbälle im Größen-vergleich darstellt. Auf dem Rückweg besuche ich noch einen im Oriental-Plaza gelegenen “Starbucks”, um bei einem Vanilla-Cappucchino zu schreiben und mir die logobedruckten Einkaufstaschen schwingenden chinesischen Yuppies anzusehen.
Auch erinnere ich mich, was einer der von mir markierten Punkte auf meinem Stadtplan bedeutet: 798 Dashanzi Art District, eine ehemalige vielgebäudige Fabriksanlage, die seit Jahren als Kunstviertel genutzt wird. Mehr als 100 Galerien und Ateliers haben sich hier eingemietet, ein Spektrum auch international bekannter Künstler ist hier beheimatet.
77
War in den letzten Jahren in der Kunstwelt ein massiver Boom von Kunst aus Asien spürbar, so sehe ich hier vermehrt, dass er berechtigt ist. Konzeptives, Dekoratives, Abstraktes, Verrücktes wird hier gezeigt, in ziegelroten, winzigen bis riesigen Räumlichkeiten. Von netter und verspielter bis offensiv fordernder Kunst – in einer Dichte und Qualität, die zumindest der auf europäischer Präsentationsflächen wie der Biennale in Venedig oder der “Art” in Basel gezeigten entspricht.
Einer der größeren Pavillons wurde von der Schweiz angemietet, um das Wirtschaftsgebiet der Gegend um Luzern zu präsentieren, allerdings kreativ und verspielt. Da gibt es den Stand des Schweizer Armeemessers, den der leckeren Lindt-Schokoladen inklusive Live-Chocolatier. An diesem Abend ist die Eröffnung der vierwöchigen Werksschau und meine Erfahrung als Gatecrasher lässt mich die gestrenge Einladungskontrolle scherzend passieren. Umgeben von Schweizer Wirtschaftstreibenden auf Managerlevel, Olymiavorbereitern und potenziellen chinesischen Geschäftspartnern empfinde ich diesen Event exotischer als das umgebende Beijing. Alphornbläser, Bundeshymnesänger, Raclette-Schmelzer beeindrucken mich und sprechen in seltsamen Dialekten.
Die spürbare Steifheit wird aufgelockert durch eine Dame, die mir gegenüber auf einer der Holzbänke sitzt und anscheinend auch Spaß an diesem skurrilen Abend hat. Ilona ist eine vielgereiste Tschechin, die seit bald 20 Jahren nach einer Scheidung die Welt bereist, in Luzern zwischenstoppend oder jetzt für ein Jahr in Beijing mit einem Auftrag in einer Sprachschule.
78
Was beim Erlernen einer Sprache natürlich nicht inklusive sein kann wird durch sie nachholbar: Eigenverständnis, Weltbild, soziales Verhalten eines Deutsch sprechenden Menschen versucht sie nahe zu bringen – mit teilweise noch ungewöhnlicheren Methoden, als das Briefing vermuten lässt. Sie stellt einerseits provokante, kulturvergleichende Fragen an ihre meist weiblichen Studenten, genauso werden aber auch zwischenmenschliche Fragen beantwortet: „Wie macht man in Europa mit dem Boyfriend Schluss?“ oder „Welche Rocklänge ist heuer in Mode?“.
Letztere Frage hat einen sehr profanen Hintergrund, sind doch im Straßenbild der Innenstadt, in Einkaufszentren und den In-Bars viele Pärchen zu sehen, deren weibliche Hälfte chinesisch ist. Managern wird auch empfohlen, sich zum Sprachtraining eine örtliche Freundin zuzulegen. Das Gegenstück, den chinesischen Lover, konnte ich nirgends erblicken. Ilona hat zur Schweizer Community ein Nahverhältnis, gibt es doch einen eigenen „Beijing Club of Swiss/Chinese Friendship“ – seit 25 Jahren. Auf jeden Fall sind alle bereit, sich mit Raclette, Pilzravioli oder Käsetellern in Miniportionen abfüllen zu lassen, und von gutem Rotwein, mit Schweizerkreuz etikettiert – aber in China gekeltert.
Die Ansprachen der Handelskammer-Delegierten werden geflissentlich überhört, die Weinstimmung vereint Ost und West, und bald sind die Präsentationsstände verlassen, man trinkt auf eleganten Sitzlandschaften im Barbereich, unter kommunistischem Ziegelmauerwerk kapitalistische Abwegigkeiten wie Cuba Libre oder Manhattan. Als es der temperamentvollen Dame langweilig wird, will sie mir eine Bar eine kurze Taxifahrt weiter zeigen: für meine Begriffe ein trauriges Kapitel von Heimweh in Verkleidung einer Trinkanstalt.
79
Irish Pubs reihen sich in einem Industriebau neben australischen Biertempeln, coole Lounge-Bars neben Rockschuppen – garantiert chinesenfrei, abgesehen vom Barpersonal. Irina bleibt noch bei einer Countryband und einem Bier, ich fahre zurück zum Galerienviertel, um mein Fahrrrad abzuholen und damit im erfrischenden Nachtwind quer durch diese aufregende Stadt ins Hotel zurückzufahren.
Als braver Tourist hat man natürlich auch Pflichten neben den Vergnüglichkeiten des individuellen Entdeckens abzuhaken: die Chinesische Mauer ruft – in Form eines Reisebüros an der Hotelrezeption, „shopping inclusive“. Das macht natürlich neugierig, vor allem, weil ich ahne, was diese Formulierung umschreibt. Um halb acht holt mich ein Kleinbus mit Führerin und Fahrer ab, unterwegs steigt ein britisches Pärchen zu. Entzückend der chinesische Akzent unserer Ausflugsleiterin, absehbar ihr eigentliches Interesse. Auf dem Weg zur Mauer werden wir eine Emaillevasenfabrik besuchen, weiters eine Jadeschnitzerei, danach die Ming- Gräber und dann quasi als Höhepunkt das Monumentalbauwerk, das vom Mond aus noch sichtbar ist. Abschließend hätten wir noch Zeit für eine Teezeremonie und vielleicht “a little footmassage“.
Die Technik des Emaillierens von Messingvasen, auf denen Motive mittels aufgeschweißten Minitrennwänden in einzelne Farbbereiche differenzierbar sind, ist aufwändig, der relativ hohe Preis verständlich, der Kaufimpuls deswegen aber nicht größer. Die Jadeschnitzerei ist ein fußballhallengroßer Industriebau, Arbeiter sieht man keine, dafür aber riesige Ausstellungsräume voll mit handwerklicher Perfektion und gestalterischen Absonderlichkeiten.
80
Jade gibt es in mehreren Grünstufen, sogar in Gelb und Weiß, die Härtegrade differenzieren, entsprechend auch der Preis. Hier gibt es dann Buddhas, Wasserbüffel oder höchst filigran gearbeitete Lotusblüten in allen Größen, emsiges Verkaufspersonal kann in vier ident eingerichteten Räumen Techniken und Materialien erklären. Wir sind augenscheinlich keine potenziellen Käufer, also dürfen wir bald weiterfahren zu den in einem Waldstück liegenden Ming-Gräbern. Im 14. Jahrhundert beschlossen einige Kaiser, hier ihre letzte Ruhestätte zu finden, sich von den eigenen Nachfahren in prunkvollen Räumlichkeiten Besuch abstatten zu lassen.
Festungsartige Wälle und Tore öffnen sich zu einem Hügel, in dem sich die eigentlichen Gräber befinden – größtenteils ungeöffnet. Nach unserem verkaufstechnischen Fehlverhalten von vorhin werden wir hier schnell durchgeschleust, die gestrenge Führerin teilt uns mit, das Mittagessen fände in einer weiteren Jadefabrik statt – und wir hätten noch vorab Zeit, deren Schauraum zu besuchen. Ein Armband mit einem Regenbogen aus Jadestücken – sogar Blau – erscheint mir dann doch als wunderschön zu Su passend bevor wir im riesigen Kundenspeisesaal gemeinsam mit großen chinesischen, ebenfalls verschleppten Reisegruppen ganz köstlich speisen.
Eddy und Roger sind zwei junge Lehrer aus Bristol, die für ein paar Tage in Beijing sind, bevor sie nach Hongkong und letztendlich nach Bangkok weiterreisen.
81
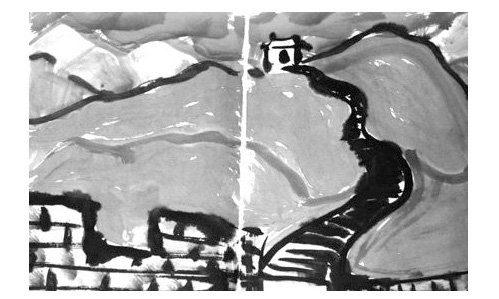
Eddy lehrt Lesen und Schreiben – für Erwachsene! – und Roger ist neben globaler Geografie auch daran interessiert herauszufinden ob und wie die Hauptstadt das Wetter für die Olympiade beeinflusst, was an dem Gerücht dran ist, dass Kleinraketendabei helfen. Auf gewundenen Straßen fahren wir in einer gebirgigen Gegend durch kleine Dörfer mit Steinhäusern, im Nebel eröffnet sich plötzlich der Blick auf dieses einst militärisch wichtige Monument, die „Chinesische Mauer“. Im 14.Jahrhundert ließ ein Ming-Kaiser bestehende Mauerteile zusammenfügen – als Präventivmassnahme nach dem Ende der Besetzung Chinas durch die Mongolen. Diese Mischung aus Wehrtürmen und steilen, massiv ummauerten Treppen hielt jedoch ein weiteres Reitervolk, nämlich die Mandschuren nicht davon ab China zu erobern – das, obwohl im 16. Jahrhundert die 6530 km lange Mauer lückenlos fertiggestellt war.
Das Mauersegment in Badaling soll angeblich meist von Touristen überlaufen sein, an diesem verregneten Dienstagnachmittag sind nur einige wenige Chinesen, eine Gruppe Inder und wir drei unterwegs. Weiter als bis zum nächsten Hügel will niemand vom Busparkplatz aus gehen, zu steil sind die Mauerteile links und rechts davon. Unsere Unsportlichkeit fällt uns vermehrt auf, sind doch überall Hinweise auf die baldige Durchfahrt der olympischen Radfahrer in Form von Tribünen und Hinweisschildern sichtbar.
82
Eddy kauft sich mit dem soeben ergangenen Recht ein „I climbed the Chinese Wall“-T-Shirt. Auf der Rückfahrt wird dann endlich das Geheimnis der letzten Programmpunkte gelüftet. Die Teezeremonie im staatlichen “Dr.Tea”- Gebäude dient natürlich dem Teeverkauf, eine routiniert ihren Text aufsagende junge Dame bleibt erfolglos, ebenso der Massagebetrieb nebenan mit Staatsbediensteten. Als Staatspräsident Jiang Zemin 1992 Tibet besuchte, soll er von drei Sachen sehr beeindruckt gewesen sein: der Landschaft, der Erkennung von Krankheiten durch Handlesen und einigen aktivierenden Essenzen, die man hier auch exklusiv kaufen kann – nach entsprechender vorheriger eingehender Betrachtung der Hände.
Wir bekommen also vorab die Füße in essenzhaltigem, warmem Wasser eingeweicht, danach von in Ausbildung befindlichen Masseuren bearbeitet. Wir dürfen uns laut Führerin glücklich schätzen, dass ein Arzt gerade im Hause ist, der unsere Handflächen nach tibetischer Art lesen wird – und das mitten in China! Kommentare über Niere und Leber führen zum Notieren einer Medizin mit der Zahl 69 und einem Dollarzeichen dahinter, ich fand die Massage eher kitzelnd bis brutal, die Show mit der Essenz, die auf Gelenken höllisch brennt solange man die Hand draufhält für unterhaltsam, die gesamte Absicht zu eindeutig kommerziell und vor allem vordergründig inszeniert.
83
Das Interesse an Tibet scheint auch in den Hunden zu stecken: Der Pekinese (eigentlich Pekingese) ist das Resultat der Liebesbeziehung zwischen dem südchinesischen kurzhaarigen Shar-Pei, berühmt für die dicken Hautfalten seiner Welpen, und dem kleinen, langhaarigen Lhasa Apso, den man in Tibet für die Wiedergeburt von Mönchen, von Lamas hält und der auch von ihnen gezüchtet wurde.
Rechtzeitig für ein völlig anderes Programm bin ich dann wieder im Zentrum: Der Night-Market beim Oriental-Plaza, eigentlich eine Reihe von Essensständen in der Nähe der Exclusiv-Hotels und eines der touristischen Stadtzentren. Was dank der Undefinierbarkeit der Spießchen vor zwei Tagen noch unbedarft genießbar war ist hier unmöglich: Die Verkäufer der mehr als 20 Buden preisen speziell den Touristen die Speisen fast wie eine Mutprobe an: „Snake“, „Snail“, „Sea horse“ ruft man mir zu, Schnecken esse ich lieber im Elsaß, mit Kräuterbutter und im Gehäuse als hier nackt am Spieß! Schlange reizt mich natürlich – schmeckt nach fast nichts und ist von der Konsistenz her zwischen Pudding und Gummi angesiedelt. Die Seepferdchen sind das personifizierte ästhetische Problem des lieblichen Tierchens, das man nicht essen kann. So nehme ich dann lieber Vorlieb mit den für mich genießbareren Knoblauchgarnelen und undefinierbar gefüllten Teigtaschen. In der Ruhe der Nacht fällt mir auf dem Weg ins Hotel wieder auf, dass Busse und Polizeiautos die passenden Texte zur Anweisung von Passanten über Lautsprecher abspielen, seltsam, wenn der männliche Chauffeur dann mit weiblicher, säuselnder Stimme kommuniziert. Mit vollem Bauch segle ich, meine Lieblingsrunden im Zentrum drehend, in Richtung Mitternacht.
84
30.07.2008
Heute bin ich mal nicht Erkunder, sondern verbringe einen Tag wie ein beurlaubter, mußekundiger Einwohner: Frühstück bei „Paris Baguette“ mit tollen Kaffee- und Kuchenkreationen, einem kosmopolitischen Publikum und Aussicht auf Shopaholics im angrenzenden Einkaufszentrum. Mittags besuche ich das gelobte vegetarische Restaurant in einer Allee nahe „The Place“ und koste mich zum Fixpreis von acht Euro durch eine breite Mischung an Speisen, die teilweise gar nicht vegetarisch aussehen. Eine davon ist optisch identisch mit den Entenbrustscheiben von vorgestern, schmeckt auch vergleichbar – ist aber garantiert aus Tofu. Das erinnert mich an ein Lokal in San Francisco, das sich damit brüstete, nur Vegetarisches zu führen, auf der Speisekarte und am Teller aber Schrimps, Hühnerfilets und sogar Steaks präsentierte, geschmacklich und von der Konsistenz her auch immer sehr nahe am Original.
Ein seltsamer Ansatz, den die Tofuwürstchen aus dem Biogeschäft zu Hause allerdings auch nicht weiterentwickelt haben! Nachmittags ein wunderbares Kunstbedarfgeschäft wegen Papieren, Tusche, Pinseln und Blancobüchern besucht, abends dann ein traditionelles Beijinger Etablissement: das Lao-She-Teehaus in dem zur Unterhaltung ein Potpourri an Stilen der Unterhaltung präsentiert wird. Besucht vor allem von Chinesen, teilweise währenddessen Karten spielend – und einigen Touristen. Das traditionell breite Spektrum des Dargebotenen reicht von einer kabarettistischen älteren Sängerin über die bekanntesten Ausschnitte aus einer Pekingoper bis zur Akrobatiktruppe – kleine Snacks und ein paar Schälchen Tee inklusive.
85
31.07.2008
Heute bin ich wieder braver Tourist und betrete endlich die „Verbotene Stadt“ unter den lächelnden Augen von Mao Dsedong. Was dieser Mann für und auch gegen sein Land getan hat, füllt Bücher: hunderttausende Tote in der Kulturrevolution, Intrigen und Verleumdungen, Machtkämpfe mit kränkelndem Charakter geführt zeichnen seinen glorreichen roten Weg, oft genug mit Blut gefärbt. Ein zutiefst menschlicher Mensch mit Verachtung gegen die kaiserliche Landesgeschichte, gleichzeitig deren Tradition des Konkubinates wiedererweckend und dieses Herzstück Beijings für seine Propaganda nutzend.
Allein schon die hier verkauften kleinen Glasstelen mit dem transparenten Foto des revolutionären, dem auf diesem Bild fast feminin wirkenden Jung-Mao und dem Gegenstück des fürs Foto breit strahlenden Parteichefs erzählen Bände, die chinesische Flagge den Rest. Der große Stern umgeben von vier kleineren stellt die kommunistische Partei dar, die Satelliten die vier unterstützenden Stände: die Bauern, die Arbeiter, die Kleinbürger – und die „patriotischen Kapitalisten“.
Ich erlaube mir aber eine gewisse Untiefe der Betrachtung, auch durch mein geringes, von Westmedien erworbenes Wissen bedingt. Ich erinnere mich dabei vergleichsweise an zum Teil intellektuelle Inder, die mich von der Großartigkeit Hitlers überzeugen wollten – und den nötigen Opfern: „He had to make sacrifices!“. Hinter der breiten Front mit der steinernen Brücke gelangt man in eine Reihe von riesigen Höfen, die man je nach eigener gesellschaftlicher Stellung für Audienzen und Feierlichkeiten nur bis zum fünften Hof betreten durfte.
86
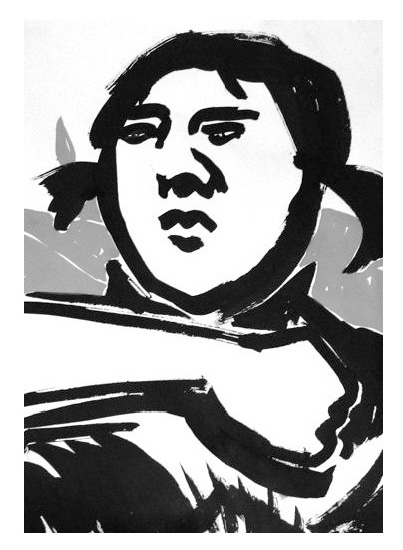
87
Dahinter befand sich der Bereich des eigentlichen Hofstaates, links und rechts die Räumlichkeiten der Konkubinen. Ein kleines, letztendlich einsames Leben in all dieser Größe: Der letzte Ming-Kaiser erhängte sich in einem benachbarten Park an einem Akazienbaum. Riesige, rot bemalte und feinst innen und am Dach verzierte Hallen mit so skurrilen Funktionen wie der Abhaltung von Neujahrsfeierlichkeiten oder der kaiserlichen Hochzeitsnacht.
In viel kleineren Proportionen ist dagegen der nordöstlich davon gelegene stilistisch ähnliche Lama-Tempel gehalten. Hier ist ein Zentrum des auch in China präsenten tibetischen Buddhismus. In fünf Höfen und Tempeln werden diverse große Figuren von Buddha und mit edlen Stoffen behangene Taras verehrt, die überragendste, ein Maitreya- Buddha, der als Erlöser erst kommt, wurde aus einem 26 Meter langen massiven Stück Sandelholz in Tibet geschnitzt und drei Jahre lang über Land hierher gebracht. Andächtig halten Chinesen Räucherstäbchen in King-Size- Größen über ihren Köpfen und verneigen sich in Richtung eines der Tempel. Schön anzusehen aber routiniert und emotionslos dargebracht wie so mancher Rosenkranz in Europa.
Göttliches Kontrastprogramm: „Hancock“ im Kino unter einem edlen Shopping-Center – die Geschichte eines gedächtnisverwirrten Übermenschen mit irregeleiteten Superkräften in Los Angeles, amüsant bis belanglos. Aus dem Kino kommend wieder die Begeisterung über den Stil der umgebenden Hotels, der Fußgängerpassagen der noblen Hotels und der Geschäfte von edlen Marken wie Montblanc oder das soeben fertig dekorierte von Armani.
88
01.08.2008
Ein Freitag, eine weitere Gelegenheit, es vielen Einwohnern dieser Stadt gleich zu tun und shoppen zu gehen. In meinem Fall, um mit bereiter Mastercard letztendlich nur drei CDs zu kaufen. Diese allerdings mit chinesischer Popmusik, soweit ich die Hülle interpretieren kann und mich nicht die Austauschbarkeit der Fotos von elfengleichen Sängerinnen eher abschreckt.
Das Spektrum der besuchten Geschäfte reicht von Malls nur zur Beglückung weiblicher Teenagerwünsche bis zu Etagen voll nobler Designobjekte in einem schwarzen Würfel namens „Galleria“. Hier findet dann inhaltlich eher Los Angeles statt, genauso wie in einer cleveren, schrägen Depandence einer örtlichen Kunsthochschule. Entlang von Parks und Straßenmärkten radle ich zu einer englischen Buchhandlung, um Lesestoff zu finden. Leider ohne Beute bringe ich dann endlich im Hotel mit Tusche in Rot, Grün, Blau und Schwarz in einem A3 großen stoffbespannten Faltbuch die in meinem Kopf gespeicherten eindringlichsten Bilder aus der Mongolei und Peking zu Papier.
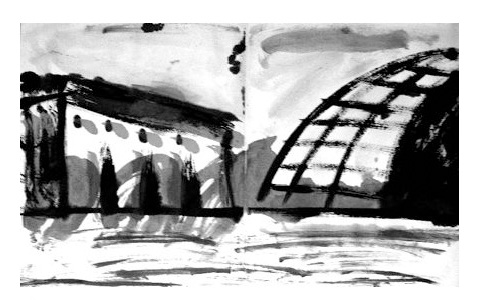
89
02.08.2008
Als ich den zweiten Ring entlang fahre und mir der Hinweis auf die „Red Gate Galery“ auffällt, meldet sich wieder meine Neugier. Ein Australier hat hier seit 15 Jahren in einem der alten riesigen Stadttore eine der interessantesten Galerien der Stadt, laut meinem Reiseführer. Tatsächlich ist in diesem nach oben offenen, über drei Stockwerke gehenden Raum – neben einer Informationsschau über die Geschichte und Renovierung des Bauwerkes – eher matte Kunst zu sehen. Kunst kommt natürlich nicht unbedingt von Können, für mich eher vom Müssen, von einem inneren Drang. Hier ist allzu Gefälliges zu sehen, teilweise Bilder, die wie großformatige Illustrationen aus einem netten Damenmode- Magazin aussehen. Gerade als ich eintrete, beginnt eine formlose Vernissage auf der europäische und chinesische Stammkunden begrüßt werden, mit Wangenküsschen links und rechts. Für das Werk einer Künstlerin kann ich mich allerdings begeistern, sie webt trockene Gräser locker zu Objekten zusammen, die in der Form Kleidern oder Flügeln gleichen, durchsetzt mit Blüten.
Ein feierliches Abendessen in einem zentral gelegenen Restaurant zu dem mich die schräge Tschechin Ilona vor einigen Tagen beim Fest im Schweizer Pavillon geladen hat, ergänzt mein Spektrum der Pekingenten-Erfahrungen um eine knusprige Variante. Die versammelten Chinesen, Thais, Tschechen und Schweizer sind anscheinend alle in der Finanz oder in der Computerindustrie tätig oder Buchhalter und Controller. Entsprechend wenig interessieren mich die Themen dieser arrivierten und saturierten Herrschaften. Mit dem Fahrrad in die laue Samstagnacht fahrend nehme ich langsam Abschied von einigen liebgewonnen Ecken dieser beeindruckenden Stadt, so auch vom rotglitzernden Coca-Cola-Eventrausch im „The Place“. Die Route ins Hotel führt ein letztes Mal über die nach wie vor beeindruckende Weitläufigkeit des Platzes vor der „Verbotenen Stadt“.
90
03.08.2008
Ein ruhiger Ausklang dieser vier Wochen ist mir jetzt wichtiger als weitere Informationseinheiten, der Ritan-Park lädt zur sonntäglichen Muße. Auch freue ich mich darauf, meine vor einigen Tagen bestellte Mao-Anzugjacke abzuholen und einen benachbarten Flohmarkt voller alter Münzen, Jade, Bücher, roter Korallen und Mao-Memorabilia zu besuchen. Der „Tempel der Weißen Wolke“ mit seinem taoistischen Götterhimmel liegt auf dem Rückweg – und mein Speicher im Kopf ist nun tatsächlich voll. Die letzte Romeo y Julietta schmeckt dann abends besonders gut, als ich in einer alten Seitenstraße zum Hotel genüsslich die letzten Wochen wie einen Farbfilm im Kopf Revue passieren lasse: Satte Grüntöne voller Stille verbinde ich mit der Mongolei, eine bunte Palette durchsetzt mit viel anthrazitfarbenem Rauschen steht für die letzten neun Tage hier in Beijing.
Ein Pekingese sitzt einige Meter vor mir auf dem Bürgersteig, und wir betrachten gemeinsam die blinkende Neonschrift eines Restaurants gegenüber. Zumindest ich rätsle, was es bedeutet, was dort wohl stehen mag…